Leseprobe
Die Kunst gilt als die edelste Leistung der Menschheit. Zuweilen hat sie einen Nimbus wie einstmals nur die Religion. Die größten Künstler, wie etwa Leonardo da Vinci oder Ludwig van Beethoven, stehen wie Sterne am Himmel und genießen eine Verehrung, auf die die früheren Götter neidisch sein könnten. Über die Musik Mozarts sagte man, sie komme direkt von Gott.
Doch die positivistische Weltsicht kennt keinen Gott. Darum kann die Kunst nicht einfach vom Himmel gefallen sein. Geht man der Frage nach, warum es überhaupt Kunst gibt, warum den Menschen die Freude daran gegeben ist, so gelangt man zu einer schockierenden Erkenntnis: Ihre Wurzeln liegen weder bei den ewigen Idealen, noch in der Religiosität, noch in der einfachen Freude am Schönen, sondern in dem Drang der Menschen, sich übereinander zu erheben, die Gesellschaft in Herren und Knechte zu scheiden. Schmuck und Kunst hatten von Beginn an keinen anderen Zweck als den der Selbstdarstellung und Machtdemonstration. Erst seit dem Zeitalter der Aufklärung lernen wir die Kunst als eigenständigen Wert zu schätzen. Der Prestigewert von Kunst ist dadurch nicht verloren gegangen. Zugleich erleben wir, wie ihr ohne die Funktion als Standesmerkmal die innere Kraft ausgeht, wie sie zur Spielwiese eines intellektuellen Hedonismus verkommt. Auch wenn sich diese Behauptungen nicht unwiderleglich beweisen lassen, gibt es doch überzeugende Gründe für ihre Berechtigung. Davon soll hier die Rede sein.
Die Wissenschaft ist sich darüber einig, daß der Kunst- und Schönheitssinn ein dem Menschen - wenn auch in sehr unterschiedlichen Graden - angeborenes Vermögen darstellt. Alle Eigenschaften aller Lebewesen sind Ergebnisse der Evolution, so auch der Schönheitssinn. Neue Eigenschaften setzen sich durch, wenn sie ihren Trägern einen Überlebens- oder Fortpflanzungsvorteil gewähren. Als die Menschen der Altsteinzeit vor fünfzig- oder hunderttausend Jahren einen Sinn für das Schöne entwickelten und erste Kunstwerke schufen, müssen sie daraus einen evolutionär wirksamen Nutzen gezogen haben.
Die Evolution wirkt nach dem schlichten Grundsatz: Es überlebt, was überlebt! Das genetische Erbgut aller Lebewesen, gleich ob Pflanze, Tier oder Mensch, unterscheidet sich geringfügig von einem Individuum zum andern. Durch Mutationen entstehen immer wieder neue Varianten. Wenn sie zum Überleben vorteilhaft sind, hat das Lebewesen eine höhere Chance als seine Artgenossen, sein besonderes Erbgut fortzupflanzen. Auch der Schönheitssinn kann nicht anders entstanden sein.
Es ist indessen nicht ohne weiteres einzusehen, warum der Schönheitssinn zu den Eigenschaften gehören sollte, die einen Überlebensvorteil bieten. Schmuck und Kunst und - allgemeiner gesprochen – alles Schöne sind nicht lebensnotwendig. Im Gegenteil: wer schöne Dinge liebt, gibt einen Teil seiner Ressourcen dafür her. Vielen Menschen bedeutet Schönheit wenig und sie überleben trotzdem, ja sie können Notzeiten leichter überstehen, wenn sie von dem Geld, das andere für unnütze schöne Dinge ausgeben, Rücklagen schaffen.
Klaus Richter ist in seinem Buch „Die Herkunft des Schönen“ der Frage nach evolutionär wirksamen Vorteilen der Schönheit nachgegangen. Am überzeugendsten ist ihm das in Bezug auf die Schönheit menschlicher Körper und Gesichter gelungen. Aber gerade da überlagern sich ästhetische mit erotischen Reizen unentwirrbar. Es ist offensichtlich, welchen Fortpflanzungsvorteil die Art daraus zieht, daß die Individuen einander gefallen. Für alle anderen rein ästhetischen Präferenzen lassen sich keine so handgreiflichen Vorteile entdecken.
Sie gewähren indessen mittelbare Vorteile, wie Geoffrey F. Miller in seinem Buch „Die sexuelle Evolution“ dargelegt hat. Er beruft sich auf das sogenannte „Handicap-Prinzip“, das Amotz Zahavi formuliert hat. Schon Darwin war aufgefallen, daß es bei vielen Tierarten scheinbar nutzlose, aber um so auffälligere und oft sogar für das menschliche Auge schöne Merkmale gibt, wie buntes Gefieder, Pfauenschwänze oder Hirschgeweihe, die die Paarungsbereitschaft fördern und sich auf diese Weise evolutionär immer deutlicher ausgeprägt haben. Das Handicap-Prinzip besagt nun, daß solche Merkmale für ihre Träger ökonomische Kosten verursachen müssen, indem sie Nährstoffe binden, Energie verbrauchen oder Freßfeinde anreizen. Ein Lebewesen, das sich luxuriöse Merkmale leisten kann, verfügt offensichtlich über eine hohe Lebenstüchtigkeit und rechtfertigt daher seine hohe Rangstellung innerhalb der Population. Und da sich diese Lebenstüchtigkeit aus seinen besonders „guten“ Genen herleitet, hat es evolutionären Sinn, wenn sich sein Träger mittels seiner auffälligen Merkmale bevorzugt fortpflanzt. Bei vielen Tierarten genießt das ranghöchste Männchen das absolute Paarungsvorrecht bei allen Weibchen. Sie sind es, die den Sieger küren.
Dieser Evolutionsweg für neue Qualitäten, bei dem die Lebenstüchtigkeit mittelbar durch spezifische Signale angezeigt wird, verläuft deutlich schneller als wenn die Überlebensfähigkeit als solche die positive Auslese der Tüchtigsten bewirkt. Sobald die Empfänglichkeit für diese Signale evolutionär gefestigt ist, schreitet die Evolution von selbst fort. Auch dann sind tausende Generationen nötig, um ein Merkmal in der Art durchzusetzen. Die Evolution des Menschen verläuft in einem Zeitmaß von –zigtausenden bis Hunderttausenden von Jahren.
Miller zeigt für eine Vielzahl menschlicher Qualitäten, wie Höflichkeit, Großzügigkeit oder Hilfsbereitschaft, daß sie derartige spezifische Signale darstellen. Sie gehorchen dem Handicap-Prinzip: sie kosten Ressourcen, aber machen beliebt und fördern dadurch die Paarbildung und die Nachkommenschaft. Zu diesen Signalen rechnet Miller auch die Kunst. Einerseits ist sie teuer, kostet also Ressourcen, andererseits gefällt sie und macht beliebt. Der Giessener Professor Eckart Voland geht sogar so weit, das Schöne mit dem Kostbaren, also dem Teuren gleichzusetzen. Obwohl es dafür überzeugende Beispiele gibt, kann kein Ästhet einer solchen Gleichsetzung zustimmen. Ein Schmuckstück mit noch so kostbaren Edelsteinen kann ästhetisch misslungen sein und würde trotz seines hohen Preises nicht als schön gelten. Andererseits kann ein Abendhimmel mit seiner Farbenpracht hinreißend schön sein, aber er kostet gar nichts. So sind die Kostbarkeit, der Luxus, die unwiederbringliche Einmaligkeit wohl häufige Begleiter des Schönen, aber sie machen nicht sein Wesen aus.
Was ist es denn, was am Schönen so fasziniert? Es lohnt sich, in dem gewaltigen Schrifttum der Ästhetik zu stöbern, das sich seit dem Altertum in den Bibliotheken angehäuft hat. Platon sah im Schönen ein Ideal, das weder in der Natur noch in der Kunst erreichbar sei. Alles Schöne, das wir kennen, enthält immer nur einen Abglanz des ideal Schönen. Plotin sah im Schönen eine Spiegelung der reinen Seele. Die vollkommen reine Seele bedürfe der schönen Dinge nicht: „Wer das überirdisch Schöne zu schauen vermag, bedarf der irdischen Schönheit nicht mehr.“ Für beide Philosophen sind alle schönen Dinge, die wir wahrnehmen, Mischformen aus irdischer und göttlicher Schönheit. Diese Komplexität des Schönen begegnet in der Philosophie immer wieder, bei Schelling als das Endliche gegenüber dem Unendlichen, Absoluten, bei Hegel als „eine der Mitten“ zwischen dem absoluten Geist und der Natur, bei Schopenhauer als „Wille und Vorstellung“, bei Nietzsche als das Dionysische und das Apollinische. In unserer Zeit sieht Friedrich Cramer Schönheit am Schnittpunkt von Chaos und Ordnung, also an dem Punkt, wo ein Formungsprozeß an seine naturgegebene Grenze stößt und im Augenblick des Umbruches etwas radikal Neues entstehen lässt.
Keine dieser Charakterisierungen erlaubt es, zwischen schönen und nicht-schönen Objekten zu unterscheiden, geschweige denn schöne Objekte zu konstruieren. Aber sie machen immerhin deutlich, daß an der Wahrnehmung von Schönheit Sinnliches und Geistiges im Wechselspiel teilhaben. Herbert Franke hat versucht, dem Schönheitssinn informationstheoretisch beizukommen. Jede Wahrnehmung von Objekten beruht auf einem Vorgang der Datenverdichtung im Gehirn. Allein vom Auge trifft ein Datenstrom von 10 Milliarden bit (kleinste Informationseinheit) pro Sekunde im Gehirn ein. Die Leistung des Gehirns besteht darin, diesen Datenstrom auf das Maximum von 160 bit pro Sekunde herunterzubrechen, das im Bewußtsein gerade noch bewältigt werden kann. Das gelingt durch stufenweises Zusammenfassen größerer Datenmengen zu sogenannten Zeichen und Superzeichen, also Kürzeln für frühere Seherfahrungen. Kunstwerke, so sieht es Franke, seien Objekte, die dieser lustbetonten Datenreduktion durch ihre eigene Struktur entgegenkommen. Auch bei dieser Deutung zeichnet sich ein Wechselspiel zwischen der sinnlichen Wahrnehmung einerseits und den Gedächtnisinhalten andererseits ab.
Der deutsche Philosoph Nicolai Hartmann unterscheidet das bloße Sehen des schönen Objekts von der „Schau“, bei der das Bewusstsein aus der Wahrnehmung der Einzelheiten des Dinges in seine Verinnerlichung als einheitliches „schönes Ding“ übertritt. In diesem Übergang lassen sich sowohl der Endpunkt der Datenreduktion nach Franke als auch der Sprung aus der Ordnung des Datenströmens in das „Chaos“ einer ganz anderen Erkenntnisebene nach Cramer wiedererkennen. Worauf es in diesem Zusammenhang ankommt ist dies: Das Schöne kann man nicht einfach sehen wie die Bläue des Himmels, sondern es bedarf zu seiner Erkenntnis eines komplizierten Wechselspiels zwischen sinnlicher Wahrnehmung und verinnerlichten Geistesinhalten. Darum bedarf das Schönheitsurteil der Erfahrung und Übung und nicht zuletzt der geeigneten Gehirnstrukturen, die das erforderliche Wechselspiel in Gang setzen. Sicherheit des Geschmacks verrät viel über die Leistungsfähigkeit des Gehirns und die „guten Gene“, die bei seiner Bildung Pate standen. Aus diesem Grund konnte sich der Schönheitssinn als evolutionär wirksame Signalempfänglichkeit im Sinne der sexuellen Evolution nach Geoffrey F. Miller entwickeln.
Wie muß man sich nun die Evolution des Menschen vorstellen? Man darf davon ausgehen, daß unsere äffischen Urahnen ebenso wie viele andere Tierarten über Rangordnungen innerhalb ihrer Populationen verfügten. Für die Rangstellung waren animalische Qualitäten, wie Körpergröße, Kraft und Mut, maßgeblich. Alle Mitglieder der Population achteten auf die Gunst- und Drohgebärden des Ranghöchsten und richteten ihr Verhalten danach. Diese Gebärden waren Gegenstand ihrer Neugier.
Die Vormenschen waren Jäger, besaßen aber weder Krallen noch gefährliche Reißzähne, um Beute zu machen. Für ihre Lebenstüchtigkeit spielten daher neben den animalischen Qualitäten mentale Fähigkeiten eine zunehmende Rolle. Sie mussten ihre Beutetiere eher überlisten als überwältigen. Folgt man den Gedanken von Geoffrey F. Miller, so mussten die Menschen angesichts eines solchen evolutionären Druckes Signale für mentale Qualitäten sowie eine entsprechende Signalempfindlichkeit entwickeln. Ein entscheidender Evolutionsschritt in diese Richtung könnte die Entstehung von Neugier für auffällige Signale gewesen sein. Auffälligkeit bedeutet, daß die Signale einerseits eindeutig wahrnehmbar sind, aber andererseits mit keinem der artspezifischen Merkmale übereinstimmen. Während in den klassischen Rangordnungen instinkthaft festgelegte Signale gelten, wird nun gerade die Abweichung davon zum eigentlichen Signal. Ein einfallsreiches Individuum legt sich beispielsweise eine Efeuranke um den Hals und stellt erfreut fest, daß es dafür Zuwendung und Anerkennung von den Artgenossen erfährt. Es wird nun derartige Aktivitäten steigern und damit die Neugier aller anderen umso mehr reizen. Ein besonders wirksames Signal wird es sich als Würdezeichen dauerhaft zueigen machen.
Die Signalwirkung des auffälligen Zeichens ist zunächst eine Spekulation, aber sie erscheint plausibel durch die bis heute anhaltende Anerkennung und Bewunderung, die sich mit „tollen“ Dingen erringen lässt. So geben Jugendliche gern mit ihren Handies an, besonders wenn sie mit den aktuellsten Klingeltönen aufwarten können. Männer sind stolz, wenn ihr Auto mehr Ventile hat als andere, auch wenn man beim Fahren davon nichts merkt. Die Steinzeitmenschen mögen sich an besonders geformten Faustkeilen ergötzt und deren Besitzer beneidet haben. Der Anspruch an die Auffälligkeit und Exklusivität der Würdezeichen wird über die Jahrtausende allmählich zugenommen haben. Damit musste die Förderung der für mentale Leistungen günstigen Gene einhergehen, das heißt: die Menschen wurden klüger. Im Verhältnis zu der gewonnenen Klugheit musste auch der Grad der Auffälligkeit zunehmen, um ein „ehrliches Signal“ zu bleiben.
Hier sprang die Evolution mit einer neuen Erfindung ein: mit dem Schönheitssinn. Das künstlich hergestellte schöne Objekt galt plötzlich als höchste Stufe des Auffälligen und Außerordentlichen. Es erfüllt zum einen das Verlangen nach Kostbarkeit, weil es schwer zu machen ist, Zeit, Geduld und Mühe und womöglich einen seltenen Werkstoff erfordert. Noch wichtiger ist die komplexe Qualität der Schönheit. Wer nicht die nötigen Gene besitzt, verfügt auch nicht über die komplexen Gehirnstrukturen, die beim Erlebnis des Schönen tätig sind. Er – oder sie – vermag sich auch nicht so schön zu machen wie jemand, der einen sicheren Geschmack hat. Für die wechselseitige Partnerwahl spielt es nicht allein eine wichtige Rolle, daß der eine den anderen mit seinem ästhetischen Gebaren zu beeindrucken vermag, sondern daß sich die Partner wechselseitig als Träger eines guten Geschmacks erkennen.
Es bildete sich eine Gesellschaft mit einer sichtbaren Rangfolge der ästhetischen Kultur. Sie dürfte zuerst am Körperschmuck ablesbar gewesen sein, etwa in Form von Bemalung der Haut oder der Kleidung oder in Form von Schmuckstücken. In altsteinzeitlichen Gräbern fand man durchbohrte Schneckenhäuser, die einmal eine Halskette gebildet hatten. Erst nachdem der Körperschmuck zum selbstverständlichen Würdezeichen geworden war, konnte die Ausschmückung des Lebensumfeldes eines Würdenträgers in seine Standesdemonstration einbezogen werden. So wurden Faustkeile nicht nur funktionsgerecht, sondern zunehmend symmetrisch geformt. Sicherlich wurden schon in der Altsteinzeit die Lagerplätze und Wohnstätten der Würdenträger ihrem Rang entsprechend ausgeschmückt.
Die frühesten erhaltenen Kunstwerke fand Nicholas Conard in Höhlen der Schwäbischen Alb: aus Mammut-Elfenbein geschnitzte Tierfiguren von stupender Schönheit mit einem Alter von 30 bis 40 Tausend Jahren. Sie mögen noch ältere Vorläufer aus Holz und ähnlichen vergänglichen Werkstoffen gehabt haben, die sich nicht erhalten haben. Damit war das Abbild erfunden, bis heute der wirkungsmächtigste Gegenstand der Kunst. Es bezieht seine Kraft einerseits aus dem lustbetonten Abgleich zwischen gesehenem Objekt und erinnertem Vorbild, andererseits aus dem Bewusstsein der Schwierigkeit des Abbildens, also der Übertragung von Einzelheiten des Vorbildes in Gestaltungselemente des Abbildes in einem anderen Material. Frühe Darstellungen von Mensch-Tier-Mischwesen zeugen davon, wie eine weitere Bewußtseinsebene einbezogen wird, nämlich die imaginierte Vorstellung.
Man hält die frühen Tierplastiken für Symbole des Jagdzaubers. Auch die weltberühmten Höhlenmalereien in Spanien und Südfrankreich werden kultisch-magisch gedeutet. Überhaupt werden die aus den Frühzeiten der Menschheit überkommenen Kunst- und Kulturgüter zu einem großen, wenn nicht sogar zum überwiegenden Teil als Kultgegenstände gedeutet. Darin liegt kein Widerspruch zum Verständnis der Kultur als Standesmerkmal. Schon in Urzeiten fühlten sich die Menschen eingebunden in eine hierarchische Ordnung, die über die lebenden Mitmenschen hinausging. Dazu konnten die Seelen der Verstorbenen, gute und böse Naturgeister, Heilige und Götter gehören. Die Grenzen zwischen den Hierarchien der Lebenden und denen der gedachten Geister waren fließend. Ägyptische Pharaonen und römische Kaiser nahmen göttlichen Rang für sich in Anspruch. Die römischen Kaiser ernannten hochgeschätzte Verstorbene förmlich zu Göttern, wie zum Beispiel Hadrian seinen verstorbenen Lustknaben Antinous. Die Selig- und Heiligsprechungen, die der Vatikan bis heute vornimmt, sind nichts anderes! Es war nur folgerichtig, die gedachten ranghohen Gesellschaftsmitglieder oder, soweit man ihrer nicht habhaft werden konnte, wenigstens die Stätten ihrer Verehrung mit den angemessenen ästhetischen Würdezeichen auszustatten. Diesem Bedürfnis verdanken wir den großen Reichtum an sakraler Kunst.
Im Zusammenhang mit den ästhetischen Würdezeichen ist eine Besonderheit der Gattung Mensch von Bedeutung, die weitreichende Folgen hatte, nämlich das Prinzip der Einehe. Sie sind so weitreichend, daß man sie als den entscheidenden Grund für die Entwicklung der Einehe ansehen muß. Anders als bei den Hirschen, wo sich der Platzhirsch mit allen Weibchen seines Rudels paart, ist beim Menschen die Zweisamkeit die instinktiv bevorzugte Regel und jede Promiskuität, auch wenn es sie gibt, verpönt. Der Hang zur Zweisamkeit ist ein Ergebnis der Evolution und als solches muß er bis tief in die Altsteinzeit zurückgehen.
Während bei den Hirschen das Weibchen die Wahl trifft und der Platzhirsch keines seiner Weibchen verschmäht, geht Geoffrey Miller von einer gegenseitigen Partnerwahl unter den Menschen aus. Männer und Frauen haben eigene Rangfolgen. Miller beschreibt die Paarbildung so, daß sich der ranghöchste Mann mit der ranghöchsten Frau verbindet. Der zweithöchste Mann nimmt die zweithöchste Frau, nicht weil sie ihm besser gefällt, sondern weil er die Ranghöchste nicht kriegen kann. Das entsprechende gilt für die zweithöchste Frau; auch sie muß mit dem zweithöchsten Mann vorlieb nehmen. So ergibt sich eine Rangfolge von Paaren, die stufenweise immer weniger gute Gene an ihre Nachkommenschaft weiterzugeben haben. Hat unter diesen Umständen die Rangordnung überhaupt noch ihren evolutionären Sinn, nämlich nur das beste Erbgut zur Fortpflanzung zu bringen? Miller sagt ja, weil das ranghöchste Paar auch die höchste Lebenstüchtigkeit besitzt und mehr Nachkommen durchbringt als die niederrangigen Paare.
Auch wenn das eher eine statistische Betrachtung ist als eine prähistorische Szenerie, muß man sich die Praxis der Paarbildung doch etwas anders vorstellen. Die Menschheit bestand in der Altsteinzeit aus frei schweifenden Jägergesellschaften von dreißig bis hundert Personen. Hätten sich innerhalb dieser Gruppen Paare zusammengetan und Kinder gezeugt, so wären sie alsbald an Inzucht zugrunde gegangen. Die einzelnen Gruppen kamen jedoch, wenn sie den Tierzügen folgten, miteinander in Berührung. Obwohl sie Jagdkonkurrenten waren, müssen solche Begegnungen wohl eher friedlichen Charakters gewesen sein. Jedenfalls wurden dabei auch technische und kulturelle Fortschritte ausgetauscht, so daß Neuerungen sich rasch über ganze Kontinente verbreiteten. Diese Begegnungen dürften für die heiratsfähigen Männer willkommene Gelegenheiten gewesen sein, sich aus der anderen Gruppe eine Frau zu wählen. Seit Menschengedenken wünscht sich jeder einen ebenbürtigen Partner. Ein Mann hohen Ranges wird auch eine Frau entsprechend hohen Ranges freien wollen. Woran erkennt er ihren Rang? Gewiß an der Kultur ihrer Erscheinung, an ihrem Geschmack. Es wäre nicht so leicht, sich solche steinzeitlichen Brautwerbungen vorzustellen, wenn sie uns nicht aus den letzten Jahrhunderten so vertraut wären.
Bis zum Ende des Ancien Régime und sogar bis weit ins 19te Jahrhundert waren die menschlichen Gesellschaften ständisch gegliedert. Die Mitglieder jeder sozialen Schicht gaben sich durch eine breite Vielfalt von kennzeichnenden Standesmerkmalen zu erkennen. Dazu gehörten die Kleidermode, die Ausstattung von Haus und Hof, das möglichst gesittete Benehmen, die Art zu sprechen und sich zu bewegen, die Vertrautheit mit der standesüblichen Kultur und ihren Sitten. Die jungen Leute wurden frühzeitig mit der standesgemäßen Kultur vertraut gemacht und gingen selbstverständlich innerhalb ihrer Schicht auf Brautschau. Innerhalb jeder Rangstufe wurde ein spezifischer Bestand an kulturprägenden Genen weitergegeben. Warum sollte es in der Steinzeit anders gewesen sein?
Errungenschaften der Evolution setzen sich durch, wenn sie mit einem Überlebensvorteil verbunden sind. Die ständisch gegliederte Gesellschaft war in dieser Hinsicht offenbar ein Erfolgsmodell. Die Einehe als ihre Voraussetzung verfestigte sich ebenso wie die kulturelle Selbstdarstellung aller Stände. Der ökonomische Erfolg der ständischen Gesellschaft beruhte zweifellos auf der arbeitsteiligen Erwerbsstruktur, die sich bis in unsere Tage erhalten hat: Der oberste Rang beansprucht die Befehlsgewalt über alle Untergebenen und beutet ihre Tätigkeit aus. Die Geschichte der Menschheit ist zu weiten Teilen eine Geschichte der Ausbeutung. Auch wenn die ständische Gesellschaft eine evolutionsbedingte Naturform ist, ist sie allein dadurch nicht moralisch gerechtfertigt. Wir haben die Gleichheit der Menschen zum gesellschaftspolitischen Grundsatz erhoben, müssen dafür jedoch in Kauf nehmen, daß die ästhetische Kultur ihre Rolle als Standesmerkmal verloren hat. Ohne diese Rolle wäre der reiche Bestand an Kunst der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende nicht entstanden. Wir ständen kulturell und wahrscheinlich auch ökonomisch noch immer auf der Stufe der frühen Steinzeit.
An dieser Stelle ist einem Mißverständnis vorzubeugen. Hätten nicht die obersten Ränge der Gesellschaften aus lauter Künstlern bestehen müssen, wenn sich diese Ränge durch fortwährende Auswahl nach dem Schönheitssinn herausgebildet hätten? Auch wenn wir nicht wissen, aus welcher Rangstufe die frühesten Steinzeit-Künstler stammten, bestehen aus heutiger Sicht Zweifel an einer solchen Schlußfolgerung; jedenfalls sind aus der überschaubaren historischen Vergangenheit keine Fälle bekannt, daß ein Herrscher zugleich ein großer Künstler gewesen wäre beziehungsweise ein Künstler zur Herrschaft gelangt wäre. Künstler waren immer Ausnahmeerscheinungen; gerade das macht ihre Werke so exklusiv. Die „guten Gene“ sind neben einer Reihe glücklicher Zufälle wohl nur eine der Voraussetzungen für hohes Künstlertum. Umgekehrt richtet sich die Rangstufe eines Menschen nicht ausschließlich nach seinem ästhetischen Vermögen, sondern auch nach viel animalischeren Qualitäten, wie Größe, Stärke, Mut und Tatkraft. Die Rolle der Künstler bestand immer darin, die ranghohen Mitglieder ihrer Gesellschaft mit den schönen Dingen auszustatten, mit denen sie erfolgreich zu imponieren vermochten.
Für unser heutiges Kulturverständnis entbehrt es nicht der Peinlichkeit, wenn wir den gesamten Bereich der Kunst, die uns geradezu heilig geworden ist, dem Bedürfnis nach Selbstdarstellung oder, um es gröber auszudrücken, der Angeberei verdanken sollen. Der stille einsame Kunstgenießer im Museum oder im Konzertsaal versteht sich nicht als Kulturprotz. Aber er ist ein Produkt der rational geprägten Endzeit. Schon in der Antike gab es Ansätze zu einem allein ästhetisch motivierten Kunstgenuß, doch im Zeitmaßstab der Evolution gehören die paar Jahrtausende der historischen Epochen zu dieser Endzeit. Die Kraft der Ratio dämpft die ursprüngliche Kraft der Instinkte zu bloßen Neigungen, denen wir uns willentlich widersetzen können. So haben wir es allmählich gelernt, Kunst hedonistisch um ihrer selbst willen zu schätzen. Aber steckt nicht auch darin eine Spur von Narzissmus, nämlich in dem freudigen Bewußtsein, mit den hochrangigen Genen des Schönheitssinnes gesegnet zu sein?
Vielleicht war die längste Zeitspanne, in der Menschen bereits mit Kunst lebten und darin Standesmerkmale sahen, nämlich die späte Altsteinzeit bis zum Beginn des Neolithikums, nicht so von Protzentum und Ausbeutung geprägt wie die geschichtlichen Perioden, von denen wir umfassende Kenntnis haben. Die Menschen in den kleinen, nicht sesshaften altsteinzeitlichen Gesellschaften mögen in Schmuck und Kleidung ihren jeweiligen Rang dargestellt und gehörigen Respekt eingefordert haben. Aber es waren überschaubare Gesellschaften, in denen jeder jeden kannte. Die ranghohen Mitglieder waren den Bitt- und Demutsgesten der Rangniederen zugänglich. Diese werden ihren bescheidenen Anteil an der gemeinsamen Jagdbeute erhalten haben, weil anderenfalls die Gruppe nicht überlebensfähig gewesen wäre. Jedenfalls kann man sich einigermaßen gedeihliche Verhältnisse vorstellen, ähnlich wie die selbstverständliche Solidarität in heutigen Kleinbetrieben mit einer ähnlich geringen Zahl von Beschäftigten.
Einen Umbruch der Verhältnisse gab es erst im Zuge der neolithischen Revolution am Ende der letzten Eiszeit vor etwa zehn- bis fünfzehntausend Jahren. Sie gilt als die tiefstgreifende Umwälzung in der Menschheitsgeschichte. Die Menschen begannen sesshaft zu werden, Vieh zu halten, Ackerbau zu betreiben und Besitz anzusammeln. Das geschah nicht auf einen Schlag und nicht in allen Gesellschaften zugleich. Die weiterhin nomadisch schweifenden Gruppen hatten keinerlei Verständnis für Eigentum und sahen in den Viehweiden der Seßhaften verlockende Jagdgründe. Zu deren Verteidigung mußten sie sich zu wehrhaften Gruppen zusammenschließen. So wurden die einstmaligen Jäger zu Kriegern. Um zum Schutze ihrer Herden in der Übermacht zu bleiben, mussten die Gesellschaften größer werden, mussten Siedlungen befestigt und Mannschaften im Kampf geübt werden. Das erforderte unbedingte Befehlsgewalt der Anführer und eine entsprechend höher gestaffelte Hierarchie. Sie musste mit entsprechend gesteigertem Aufwand ästhetisch zum Ausdruck gebracht werden. Je größer die Stämme wurden, um so weiter wurde der Abstand zwischen den obersten und den untersten Rängen, um so weniger waren die Herrschenden für die Bitt- und Demutsgesten der Unteren erreichbar.
Nachdem die sesshaft gewordenen Stämme gelernt hatten, sich der schweifenden Jäger zu erwehren, kamen sie auf die Idee, ihre Macht kriegerisch auf benachbarte sesshafte Stämme auszuweiten. So entstanden aus kleinen Stammesherrschaften zuerst kleine und dann immer größere Königreiche. Der ästhetische Aufwand, mit dem sich die Könige schmückten, wuchs in unermessliche Höhen. Um die gestiegenen Ansprüche zu befriedigen, brauchte man Arbeitskräfte und fand sie in den unterworfenen Völkern. So entstand der neue soziale Stand der Sklaven. Natürlich standen sie am untersten Ende der Rangskala, auch wenn sie einstmals höheren Rängen angehört hatten und an deren Genbestand teilhatten. So wurde die evolutionär entwickelte Rangstufenfolge, in der die genetische Varietät zum Ausdruck kam, erstmals durchbrochen. Im Laufe der späteren kriegerischen Geschichte geschah das immer wieder.
Eine weitere Neuheit der Jungsteinzeit war die beginnende Kolonisation. In den sesshaften Völkern kam es zu Menschenüberschüssen. Kleinere Gruppen wanderten aus und suchten sich weit entfernt neue Siedlungsplätze, wo sie die dort noch lebenden Sammler- und Jägergesellschaften mittels ihrer überlegenen Kultur- und Kriegspraktiken verdrängten oder zu Sklaven machten.
Kerngebiet der neolithischen Kulturen war der vordere Orient. Dort entstanden die ersten Großreiche der Ägypter und Babylonier mit ihrer ungeheuren Prachtentfaltung. Sie wurde zur Darstellung der königlichen Macht als unerlässlich angesehen. Wer einen Überblick über den weiteren Verlauf der Kunstgeschichte hat, der weiß, in welche Hybris von Glanz- und Prunkentfaltung dieses zwanghafte Selbstdarstellungsbedürfnis hineinführte. Ständige Kriege und Unterwerfungen führten dazu, daß von dem ursprünglichen evolutionär entwickelten Zusammenhang zwischen ästhetischer Erscheinung und „guten Genen“ nicht mehr viel übrig blieb. Die kulturträchtigen Gene waren schließlich in allen Bevölkerungsschichten anzutreffen, auch wenn sie sich in sozial aufsteigenden Schichten immer wieder erneut ansammeln konnten.
Solange die Darstellung fürstlicher Macht mit ästhetischem Aufwand ungebrochen andauerte, also bis zum Ende des Ancien Régime, solange galt die Übereinstimmung von Kunst und Schönheit. Ästhetische Machtsymbole, wie Paläste, Tempel oder Kirchen, wären ohne Schönheit nicht gemeinverständlich und somit auch nicht machtwirksam gewesen. Deshalb konnte Kunst mit schöner Kunst gleichgesetzt werden.
Dieses Selbstverständnis ist inzwischen verloren, spätestens seit Pablo Picasso im Jahr 1906 seine „Madmoiselles d’ Avignon“ malte. Keine Madmoiselle dieser Zeit hätte sich darin wiedererkennen mögen, geschweige denn sie zum ästhetischen Vorbild genommen. Die Entwicklung dahin hatte natürlich weit früher eingesetzt, schon bald nach der Französischen Revolution. Diese hatte den Zusammenhang von Pracht und Macht nachdrücklich in Frage gestellt. Die große Kunst war herrenlos geworden und wurde vom erstarkenden Bürgertum nur zögerlich in Obhut genommen. Der in bürgerlichen Händen entstehende Historismus und Eklektizismus brachte keine große Kunst mehr zuwege. Diese suchte sich in Sezessionen neue Bahnen und beanspruchte die Autonomie der Kunst. Nicht mehr die Fürsten, sondern die Künstler selbst bestimmten, was Kunst sei. Die Vielfalt der Neigungen und Vorlieben der Künstler ließ eine entsprechende Vielfalt von Stilen, Richtungen und immer neuen –ismen hervorsprudeln. Elemente des Auffälligen und Außerordentlichen gewannen in der Kunst gegenüber denen der Schönheit zunehmende Bedeutung.
Wie kam es zu diesem – im Maßstab der Weltgeschichte – plötzlichen Bruch einer seit Jahrzehntausenden andauernden Kulturtradition? Warum verlor die Kunst ihre existentielle Bedeutung für die soziale Stellung der herrschenden Gesellschaft?
Die Antwort liegt in der Evolutionsgeschichte der Menschheit selbst, nun aber wohlgemerkt nicht der genetischen, sondern der mentalen Evolution. Die komplexe Natur des Schönen war das Vehikel, an dem der Mensch lernte, auch außerhalb des ästhetischen Bereichs unterschiedliche Geistesinhalte in Zusammenhang zu bringen, seien es aktuelle Wahrnehmungen oder Erinnerungen. Die dafür entwickelte mentale Maschinerie erwies sich als anwendbar auf immer komplexere Zusammenhänge. Offenbar bedurfte es dazu einer von der Sprache getragenen mentalen „Software“, die von Mensch zu Mensch und von Generation zu Generation weitergegeben und weiterentwickelt wurde. Die abendländische Kulturgeschichte ist ein Spiegel dieser über Jahrhunderte und Jahrtausende fortschreitenden Entwicklung. Aber sie fand in vergleichbarer Weise in den amerikanischen Kulturvölkern statt, die seit der Altsteinzeit keinen Austausch mehr mit der alten Welt hatten.
Mit der Aufklärung im 18ten Jahrhundert überschritt die mentale Evolution im Abendland eine entscheidende Schwelle. Das rationale Denken gewann endgültig die Oberhand über die mittelalterlich-mythischen Denkstrukturen. Die ästhetische Legitimation fürstlicher Macht fand keine Anerkennung mehr. Throne stürzten oder schrumpften auf machtlose Symbole. Der von Rationalität beherrschte moderne Mensch sieht sich selbst als Machtfaktor und verlangt keinen Prunk zum Beweis der Staatsgewalt. Demokratie funktioniert ohne Kunst. So verkam die Kunst zum hedonistischen Zeitvertreib. Bei aller Liebe zur großen Kunst vergangener Zeitalter verdrängen wir gern, daß sie einst Sinnbild der Macht war, so wie ihre damaligen Auftraggeber verdrängten, daß sie zugleich Sinnbild der Ungleichheit und erfolgreicher Ausbeutung war.
Die kulturgünstigen Gene sind indessen auch in der heutigen Gesellschaft nicht verloren gegangen. Noch immer lassen sie den, der damit gesegnet ist, zum Künstler oder Kunstfreund werden. Das heilige Erschauern, das in Urzeiten dem Ranghöchsten oder den hierarchisch noch darüber gestellten Geistern und Göttern galt, wird heute der Kunst als solcher zuteil. Diesem Urgefühl verdanken wir die liebevolle Erhaltung der alten, ihrer einstmaligen Symbolwirkung entblößten Kunst.
Gewiß: Es gibt weiterhin Kunst. Sie lebt in einer eigenen Welt, abgekoppelt von den gesellschaftlichen Machtstrukturen, getragen von einer exklusiven Minderheit, die damit Aufmerksamkeit erregt, ohne das Bewusstsein der Gesamtgesellschaft so zu prägen, wie das der Hochkunst vergangener Zeiten gelang. Eine ästhetisch geprägte Kultur, die Aussicht hätte, Jahrhunderte zu überdauern und spätere Generationen in ihren Bann zu ziehen, vermag auf dem rational durchtränkten Boden der Demokratie und unter der bläßlichen Sonne der Gleichheit nicht zu gedeihen.
Bibliographie
Nicholas Conard, Woher kommt der Mensch?/ Die Entstehung der kulturellen Modernität, Attempto Verlag, Tübingen 2004
Friedrich Cramer, Wolfgang Kaempfer, Die Natur der Schönheit, Insel-Verlag, Frankfurt, 1992
Ralf Dahrendorf, Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, Sammlung Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, Band 232, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen 1966
György Doczi, Die Kraft der Grenzen - Harmonische Proportionen in Natur, Kunst und Architektur, amerikanische Originalausgabe 1981, deutsch von Uta u. Stefan Szyszkowitz, Capricorn Verlag, Glonn, 1987
Herbert Werner Franke, Phänomen Kunst - Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Ästhetik, (Informationstheorie), Heinz Moos-Verlag, München 1967
André Leroi-Gourhan , Die Religion der Vorgeschichte, Edition Suhrkamp 1981, Kapitel V
Nicolai Hartmann, (1882 - 1950), Ästhetik, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1953
Hirschberger, Geschichte der Philosophie, 1952
Paul Leyhausen siehe Konrad Lorenz (1969)
Konrad Lorenz, Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung, in der Zeitschrift für Tierpsychologie, Band 5, 1943, Seiten 235 – 409
Das sogenannte Böse – Zur Naturgeschichte der Aggression, Dr.G.Borotha-Schöler Verlag, Wien 1963
Konrad Lorenz u. Paul Leyhausen, Antriebe tierischen und menschlichen Verhaltens, R. Piper & Co Verlag, München 1969
Franz Koppe, Grundbegriffe der Ästhetik (betr. Literatur) , Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1983
Franz von Kutschera, Ästhetik, Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1988
Winfried Menninghaus, Das Versprechen der Schönheit, Suhrkamp 2003
Geoffrey F. Miller, Die sexuelle Evolution, Partnerwahl und die Entstehung des Geistes, Spektrum akademischer Verlag 2001
Desmond Morris, Der nackte Affe, Droemer Knaur 1968
Axel und Christa Murken, Von der Avantgarde bis zur Postmoderne - Die Malerei des 20. Jahrhunderts, Verlag Klinkhardt & Biermann, München 1991
Eckhard Neumann, Funktionshistorische Anthropologie der ästhetischen Produktivität, Reihe Historische Anthropologie, herausgegeben vom Forschungszentrum für Historische Anthropologie der Freien Universität Berlin, Band 26, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1996
Plotin, (205 - 270 n.Chr.), Schriften, Das Schöne
Pierre-Joseph Proudhon, Von den Grundlagen und der sozialen Bestimmung der Kunst, französische Erstausgabe 1865, deutsche Übersetzung von Klaus Herding, Wissenschafts-Verlag V. Spiess, Berlin 1988
Klaus Richter, Die Herkunft des Schönen - Grundzüge der evolutionären Ästhetik, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1999
Norbert Schneider, Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung bis zur Postmoderne,
Philipp Reclam jun., Stuttgart 1996
Wolfgang Steinig, Als die Wörter tanzen lernten, Spektrum akademischer Verlag, 2007
Eckart Voland, Das ‚Handicap-Prinzip’ und die biologische Evolu tion der ästhetischen Urteilskraft in Ralf Schnell, Wahrnehmung – Kognition – Ästhetik, Neurobiologie und Medienwissenschaften, transcript Medienumbrüche Band 12, 2005
Helmut Walther, Nürnberg , Das Gefühl für das Schöne - Ansätze zu einer evolutionären Ästhetik, Internet-Veröffentlichung 1998
[...]
- Arbeit zitieren
- Peter Huch (Autor:in), Die Erfindung der Kunst. Eine These über die Evolution des menschlichen Schönheitssinnes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518391
Kostenlos Autor werden
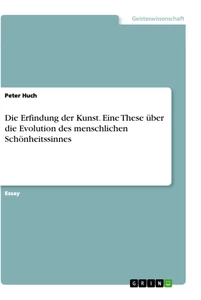

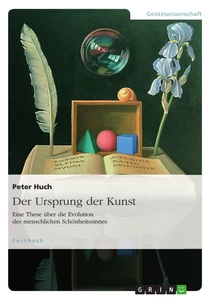
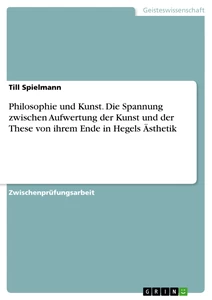

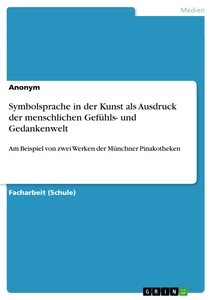

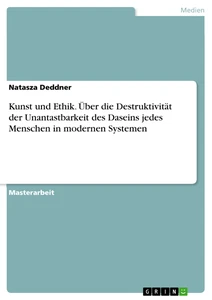
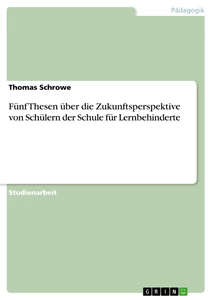
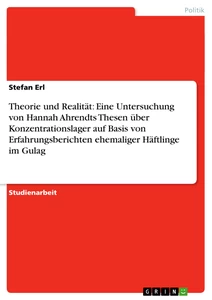
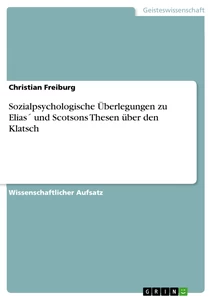

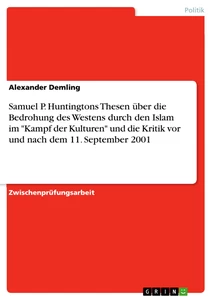
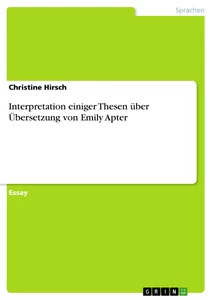

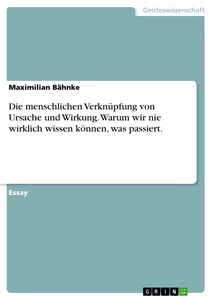

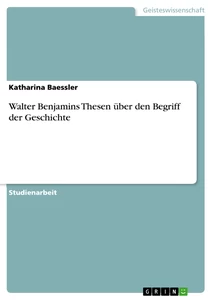

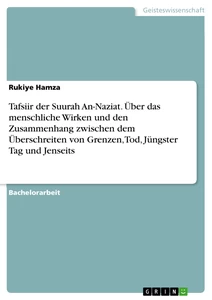
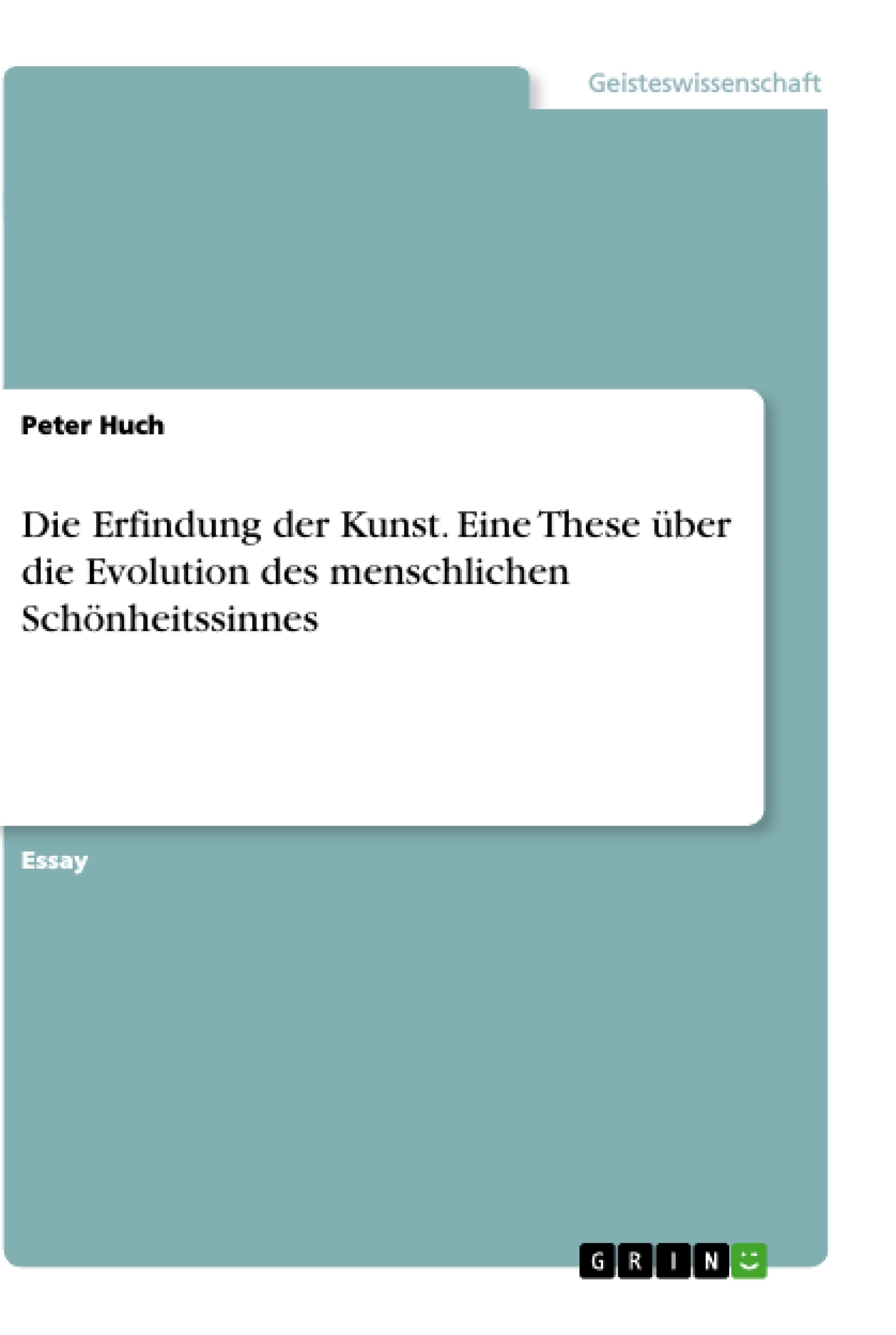

Kommentare