Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zur Definition des kulturellen Leuchtturms
3 Zum Verhältnis von Museum und Stadt
3.1 Die geschichtliche Entwicklung der Rolle von Museen in Städten
3.2 Kultur und Stadtplanung
3.3 Kultur und Stadtmarketing
3.4 Kultur und Tourismus
3.5 Die Relevanz von Kultur für das Image einer Stadt
3.6 Die Rolle der Museumsarchitektur
4 Kulturelle Leuchttürme in der Praxis
4.1 Allgemeine Beobachtungen
4.2 Bilbao und Guggenheim
4.2.1 Hintergründe der Zusammenarbeit
4.2.2 Zur Kooperation zwischen der Stadt Bilbao und der Guggenheim Foundation
4.2.3 Auswirkungen auf die Stadt Bilbao
5 Risiken und Potentiale einer Inwertsetzung von Region durch kulturelle Prestigeobjekte
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
8 Internetquellen:
1 Einleitung
Städte stehen heute mehr denn je in Konkurrenz zueinander. Nicht zuletzt im Kontext der Globalisierung befinden sich städtische Metropolen in einem Wettbewerb um ökono-misches, kulturelles und soziales Kapital. Sie konkurrieren auf nationaler und in zunehmendem Maße auch auf internationaler Ebene mit anderen Städten um die Ansiedelung von Unternehmen, wirtschaftlichen Investoren, wissenschaftlichen Einrichtungen und qualifizierten Arbeitskräften. Darüber hinaus stehen sie auch als Lebensraum zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen sowie als Freizeit- und Erholungsregionen in Konkurrenz zueinander und wetteifern somit um finanzkräftige Einwohner und Besucher.
Vor dem Hintergrund dieses Konkurrenzverhältnisses lassen sich im Hinblick auf die Entwicklung und gegenwärtigen Erscheinungsformen von Städten für den kulturellen Bereich zwei vermeintlich gegenläufige Schwerpunktsetzungen kulturellen Wirkens feststellen:[1] Zum einen sind Städte bestrebt, im Sinne einer Verwirklichung des Modells einer sozialen Stadt eine kulturelle Vielfalt um ihrer selbst Willen und für ihre Bewohner zu sichern, zu fördern und anzuregen. Zum anderen ist zu beobachten, dass Städte sich immer häufiger verstärkt um die Realisierung kultureller Großprojekte bemühen. Der Verteilung des kulturellen Engagements steht hier eine Fokussierung auf ein Großprojekt gegenüber. Im Wettstreit um Aufmerksamkeit sind solche Städte mehr denn je bestrebt, Alleinstellungs-merkmale herauszubilden, um diese als einzigartig und sich von anderen Städten abgrenz-end nach außen zu kommunizieren und zu vermarkten. Mit der Initiierung kultureller Prestigeprojekte – häufig gekennzeichnet durch eine auffällige Architektur – wird oft die Hoffnung verbunden, auch und vor allem überregional nachhaltig Ansehen zu erlangen.
In der vorliegenden Arbeit soll die Bedeutung von kulturellen Prestigeprojekten, so genann-ten kulturellen Leuchttürmen, näher beleuchtet und analysiert werden. Hierfür werde ich zunächst näher auf das Verhältnis von Kultur und Stadt sowie den Museumsboom der 1980er und 1990er Jahre mit besonderer Fokussierung auf die Museumsarchitektur ein-gehen. Als wohl populärstes Beispiel für einen kulturellen Leuchtturm, der vor allem durch seine Architektur besticht, wird die Stadt Bilbao mit ihrem von Frank O. Gehry entworfenen Guggenheim Museum näher betrachtet. Daran anschließend werden die Risiken und Poten-tiale kultureller Leuchtturmprojekte herausgearbeitet mit dem Ziel herauszufinden, welche Auswirkungen diese sowohl für den Kulturbereich selbst als auch andere Bereiche des Städtischen haben können.
2 Zur Definition des kulturellen Leuchtturms
Auch wenn der Begriff des kulturellen Leuchtturms kein allgemeinverbindlich festgeschrie-bener ist, so soll er dennoch in der vorliegenden Hausarbeit für die Bezeichnung kultureller Prestigeprojekte verwendet werden. Die wenigen in der Literatur postulierten Definitions-versuche unterscheiden sich hierbei vor allem im Hinblick auf die Charakteristika, die einen Leuchtturm der Kultur ausmachen. Während die angebotene Qualität einer Kulturinstitution für einige Vertreter das zentrale Kriterium eines kulturellen Leuchtturms ist, stellen für andere hohe Besucherzahlen, vor allem aber die überregionale und internationale Strahlkraft einer Institution die zentralen Merkmale eines solchen dar.[2] Verwendet wird der Begriff auch im sogenannten Blaubuch der Bundesregierung. Hier werden Museen und Einrich-tungen des nationalen Kulturerbes der neuen Bundesländer als kulturelle Leuchttürme bezeichnet.[3] Das in den 1990er Jahren verabschiedete Leuchtturm-Programm der Bundes-regierung sah vor, dass „kulturelle Einrichtungen ‚im gesamtstaatlichen Interesse’ aus den neuen Bundesländern gefördert und dauerhaft gesichert werden sollten. Dass sich in vielen dieser Institutionen Kulturgüter von Weltrang verbargen, hat man mit Blick auf die Staat-lichen Kunstsammlungen Dresden, die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg oder die Franckenschen Stiftungen in Halle an der Saale erkannt.“[4]
Unterschieden werden muss vor diesem Hintergrund also zwischen kulturellen Leucht-türmen, die im Laufe der Zeit aufgrund ihrer inhaltlichen Substanz und ihrer Qualität Anerkennung gefunden haben und über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen, und solchen, die bewusst konstruiert – oftmals unter Einsatz wirkungsvoller architektonischer Mittel – und durch ein geschicktes Marketing zu solchen gemacht werden. In der vorliegen-den Arbeit orientiere ich mich an diesem zweiten Verständnis eines kulturellen Leuchtturms – den bewusst initiierten kulturellen Prestigeprojekten. Denn wie eingangs bereits erwähnt, ist es eine seit längerem zu beobachtende Entwicklung, dass Städte aus verschiedenen, im weiteren Verlauf der Arbeit noch thematisierten Motivationen heraus in kulturelle Groß-projekte investieren. Doch wie kommt es, dass man der Kultur und Museumsbauten im Speziellen heutzutage eine solch einflussreiche, die Stadt prägende Funktion zuweist? Ein Blick auf das Verhältnis von Kultur respektive Museum und Stadt soll im Folgenden eine Kontextualisierung des Themas möglich machen. Hierbei soll herausgearbeitet werden, dass auch und vor allem die gesellschaftliche Entwicklung ihren Anteil an dem konstatierten Wandel hat.
3 Zum Verhältnis von Museum und Stadt
3.1 Die geschichtliche Entwicklung der Rolle von Museen in Städten
Wie einleitend bereits skizziert, befinden sich Städte heute in einem harten Wettbewerb mit Ihresgleichen. Häufig sind es baugestützte Bemühungen, die diesen Konkurrenzdruck und die Orientierung an nationalen und in Folge der Globalisierungs- und Modernisierungs-tendenzen auch internationalen Benchmarks deutlich machen.[5] Besonders sinkende Einwohnerzahlen, fehlende Investitionen und ausbleibende Besucher begründen den Handlungsdruck auf Städte – vor allem in strukturschwachen Regionen. In dem Bestreben architektonische Anziehungspunkte zu schaffen, entstanden im Zuge des Städtewettbe-werbes in vielen europäischen Städten in den vergangenen 30 Jahren Flughäfen, Büro-türme, Hotels, Wohnviertel, Einkaufspassagen und vieles mehr. Dies führte jedoch nicht zu der gewünschten Profilbildung einer Stadt, sondern bewirkte gar das Gegenteil. Viele Städte offerierten ähnliche Angebote und wurden im Zuge dessen immer austauschbarer. Im Laufe der Jahre konnten die meisten Städte mit ähnlichen Standortfaktoren und Leistungen auf-warten. Fortan reichten diese Zeichen wirtschaftlichen Reichtums als strategisch gesetzte Alleinstellungsmerkmale nicht mehr aus. Vielmehr erkannte man, dass die kulturelle Attraktivität einer Stadt für deren Außenwirkung von hoher Bedeutung ist,[6] was dazu führte, dass den kulturellen Werten einer Region oder einer Stadt zunehmend mehr Bedeutung beigemessen wurde. Diese Erkenntnis führte innerhalb der vergangenen drei Jahrzehnte zu einer verstärkten Fokussierung auf neue Bauvorhaben – die Errichtung von Theatern, Operngebäuden sowie auch und vor allem von Museen.[7]
Die 1980er und 1990er Jahre zeichneten sich in der Bundesrepublik Deutschland durch einen regelrechter Museumsboom aus. Dieser manifestierte sich jedoch weniger in einer zunehmende Rezeption von Museen respektive Ausstellungsinhalten und daraus resultier-enden steigenden Besucherzahlen, sondern vielmehr in einem Boom von Um-, Erweiter-ungs- und vor allem Neubauten von Museen. So stieg die Zahl der Museen zwischen 1982 und 2000 von 1.454 auf 4.523, die Zahl der Kunstmuseen in der selben Zeit von 200 auf 486. Die Gründe für diesen Museumsbauboom sind sowohl in dem bereits damals besteh-enden Konkurrenzverhältnis der Städte und in den an Neubauten geknüpften Erwartungen einer Stadtprofilierung und Erzeugung von Urbanität zu sehen, als auch in den damaligen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen. Folgt man den Ausführungen Gerhard Schulzes, so wurden Museen zu der damaligen Zeit bedeutsamer, weil sich in der Gesellschaft eine zunehmende Orientierung am Erlebnis feststellen ließ.[8] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stieg ab Mitte der 1960er Jahre der Lebensstandard in Deutschland wieder. Steigende Einkommen und eine Reduzierung der Arbeitszeit veränderten das Alltagsleben der Menschen und trugen dazu bei, dass das Handeln der Menschen entgrenzt wurde. Auf einmal wurde die Bevölkerung aufgrund des ungewohnten Wohlstandes mit unzähligen Entscheidungsmöglichkeiten – vor allem hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung – konfrontiert. Mit der Bereitstellung neuer Angebote reagierten die Museen in ihrer neu zugewiesenen Rolle als Anbieter der Freizeitindustrie darauf, dass die Menschen nun mehr freie Zeit zur Verfügung hatten und sich somit die Zahl der potentiellen Besucher erhöhte.[9] Die „Verführung zum Museum“[10] ging somit unmittelbar in die Bauplanung über und auch die bereits in den 1970er Jahren aufgekommene Forderung nach einer Anhebung des Bildungs-niveaus bekräftigte die Notwendigkeit zum Bau neuer Museen. Folglich war der Museums-bauboom unweigerlich mit der Transformation der Gesellschaft verknüpft.
3.2 Kultur und Stadtplanung
Im Hinblick auf die Initiierung und Realisierung, aber auch Kritisierung kultureller Leucht-turmprojekte lassen sich verschiedene Interessensgemeinschaften ausmachen. Neben der Stadt selbst, die über ihr Stadtmarketing oftmals als Initiator solcher Projekte fungiert, sind auch die Kulturinstitutionen sowie die Kunst selbst und nicht zuletzt die Bewohner einer Stadt, über deren Lebensraumgestaltung verhandelt wird, von den Entscheidungen und zukünftigen Entwicklungen betroffen. Im Kontext kultureller Prestigeobjekte ist es daher interessant zu eruieren, was diese im Rahmen einer sich zunehmend verschärfenden Städte-konkurrenz an Distinktionsgewinn für das Gemeinwesen einer Stadt bedeuten können.
Der Kulturbereich erfuhr in den letzten Jahrzehnten, wie bereits erwähnt, aufgrund seiner Potentiale und seines Wertes für eine Stadt oder Region eine gesteigerte Anerkennung und Wertschätzung. Zu den Ende der 1980er Jahre aufkommenden kulturökonomischen Forder-ungen nach einer Professionalisierung des Kulturbetriebs und einer stärkeren Orientierung an den wirtschaftlichen Größen ‚Angebot’ und ‚Nachfrage’ gesellte sich auch eine neue kulturpolitische Sichtweise auf Kultur. Man wurde sich ihrer ökonomischen Potentiale bewusst, so dass Kultur als Folge dessen zu einem – dem wirtschaftlichen Vokabular ent-stammenden – weichen Standortfaktor erklärt wurde.[11] Hinzu kam die Erkenntnis, dass Kultur auch als Motor der Stadtentwicklung fungieren könne, was zu einer Steigerung ihres Ansehens innerhalb der Stadtplanung führte.[12] Aus dem Bewusstsein heraus, dass neben den Geschäftszentren auch die Standorte der hochkulturellen Einrichtungen das „Herz der Stadt“[13] definieren, begann man, Kulturinstitutionen bewusst auch in Randgebieten zu positionieren.[14] Besonders für die 1980er und 1990er Jahre lassen sich zwei vermeintlich gegenläufige Polarisierungen im Hinblick auf den Einsatz von Kultur für die Stadtplanung konstatieren: Zum einen wurde versucht, mittels der Erzeugung einer kulturellen Dichte im Stadtzentrum urbane Qualität wiederherzustellen – beispielsweise durch Kulturmeilen oder Museumsufer –, gleichzeitig wurde aber auch über die verteilte Ansiedlung kultureller Institutionen in zentrumsfernen Stadtteilen die Bildung neuer Zentren angestrebt. Als erstes europäisches Projekt einer derartig gewichteten Planungspolitik kann der Bau des Centre Pompidou in Paris angesehen werden.[15] Mit seiner Platzierung in einem der Problembezirke Paris’ gelangte nicht nur das Gebäude, welches als Kulturzentrum unter anderem ein Kunst-museum, eine Bibliothek und Konferenzräume beherbergt, zu besonderem Ansehen, sondern es bewirkte auch eine enorme Aufwertung der umliegenden Quartiere. Ein ähnlich-er Prozess lässt sich auch für die Londoner Tate Modern feststellen, die auf das umliegende, einst heruntergekommene und wertlose Gebiet wie eine „städtebauliche Initialzündung“[16] wirkte. Nach Eröffnung des Museums siedelten sich Gastronomiebetriebe, Galerien, Geschäfte und Büros in der Umgebung an. Ziel dieser neuen, die Kultur nutzenden Stand-ortplanung war zum einen die Inwertsetzung benachteiligter Stadtgebiete, die man mittels entsprechender Revitalisierungsmaßnahmen in Form kultureller Angebote zu erzielen versuchte. Zum anderen wollte man aber auch durch eine – häufig ein Kriterium darstell-ende –verkehrsgünstige Lage für regionale und überregionale Besucher gut erreichbar sein und dadurch den Kreis potentieller Besucher erweitern.
3.3 Kultur und Stadtmarketing
Neben dem städteplanerischen Bereich wurde auch von anderen städtischen Einrichtungen die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine Stadt in der vergangenen 15 bis 20 Jahren zunehmend betont.[17] Neben den kommunalen und Landesbehörden entdeckten insbesondere die Tourismus- und Stadtmarketing-Agenturen die Relevanz, die Kultur für eine Region haben kann. Die erklärten Ziele des nun im Fokus stehenden Stadtmarketings definieren sich wie folgt: „Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt/Region, Identifikation der ansässigen Unternehmen mit ihrer Stadt/Region, Imagebildung der Stadt/Region bei Gästen und Besuchern.“[18] Eine abstrakte Definition von Susanne Schäflein hinsichtlich des Bereichs Stadtmarketing zeigt, wie die Gewichtung der drei erklärten Ziele zu bewerten ist. Demnach kann Stadtmarketing als „Philosophie und Handlungsanweisung, die die Inhalte, das Verfahren und das ‚Verkaufen’, die Vermittlung nach innen und außen umfasst“[19] beschrieben werden. Wie bereits die Begrifflichkeit impliziert, geht es bei Stadtmarketing auch und vor allem um die Vermarktung einer Stadt – nach innen wie nach außen. Je mehr sich der Wettbewerb mit anderen Städten also intensiviert, desto wichtiger erscheint die Arbeit des Stadtmarketings, um das jeweilige Besondere einer Stadt zu vermarkten und somit die Stadt für die gewünschten Zielgruppen – Firmen, Besucher und Bewohner – attraktiv und unterscheidbar zu machen.
[...]
[1] Vgl.: Heinze, Dirk: „Was macht die Kultur in Europa? Der kulturpolitische Kongress in Berlin“, in: Kulturmanagement Network (Hg.): Kultur und Management im Dialog, Nr. 9, Juli 2007, unter: http://www.kulturmanagement.net/downloads/magazin/km0707.pdf, Stand: 05.10.2007, S. 15. Heinze merkt bezüglich seiner Aussage, dass es sich um zwei vermeintlich gegenläufige Trends handelt, jedoch an, dass dies für Adolf Muschg im übrigen zwei Konzepte sind, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Vielmehr müsse man „in Und-Beziehungen denken“, so Muschg. Diesem Verständnis, dass beide Phänomene auch nebeneinander existieren können, schließe ich mich an.
[2] Vgl.: Sorge, Sarah: „Leuchttürme in der Kulturpolitik“, in: Kulturmanagement Network (Hg.): Kultur und Management im Dialog, Nr. 9, Juli 2007, unter: http://www.kulturmanagement.net/downloads/magazin/km0707.pdf, Stand: 05.10.2007, S. 5ff
[3] Das Blaubuch umfasst eine nach ihrer Priorität geordnete Liste von 20 gesamtstaatlich bedeutsamen Kulturstätten, die detailliert beschrieben und teilweise vom Bund gefördert werden. Vgl. hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_kulturellen_Leuchtt%C3%Bcrme, Stand: 19.10.2007.
[4] Dümcke, Cornelia: „Leuchttürme als Orientierung?“, in: Kulturmanagement Network (Hg.): Kultur und Management im Dialog, Nr. 9, Juli 2007, unter: http://www.kulturmanagement.net/downloads/magazin/km0707.pdf, Stand: 05.10.2007, S. 3f.
[5] Vgl. hierzu und im Folgenden: Puhan-Schulz, Franziska: Museen und Stadtimagebildung: Amsterdam – Frankfurt am Main – Prag. Ein Vergleich, transcript Verlag, Bielefeld 2005, S. 25ff.
[6] Vgl.: Schäflein, Susanne: Freizeit als Faktor der Stadtentwicklungspolitik und –planung. Stadtmarketing für mehr Lebensqualität? Selbstverlag by „Rhein-Mainische Forschung“, Frankfurt am Main 1994, S. 139.
[7] Vgl. hierzu und im Folgenden: Puhan-Schulz 2005, S. 13f.
[8] Vgl.: Volkmann, Ute: „Das Projekt des schönen Lebens – Gerhard Schulzes ‚Erlebnisgesellschaft’“, in: Schimank, Uwe; Volkmann, Ute (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I, Opladen 2000, S. 75ff.
[9] Faktisch blieb der gewünschte Besucherboom jedoch aus. Von 1981 bis 1996 nahmen die Besucherzahlen an deutschen Museen sogar um 39 % ab. Vgl. hierzu ausführlicher: Kirchberg, Volker: Gesellschaftliche Funktionen von Museen. Makro-, meso- und mikrosoziologische Perspektiven, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, S. 23ff.
[10] Pehnt, Wolfgang: „Das Museum als Ausstellungsgegenstand“, in: Schriftenreihe Forum (Hg.): „Kunst im Bau“, Steidl Verlag, Göttingen 1994, S. 15.
[11] In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird zwischen harten und weichen Standortfaktoren unterschieden. Zu den harten Standortfaktoren zählen unter anderem die geografische Lage einer Stadt sowie die vorhandene Infrastruktur. Zu den weichen Standortfaktoren beispielsweise der Charme sowie die Lebensqualität, die eine Stadt ausmachen, und auch ein vielfältiges, ansprechendes und qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot. Standortfaktoren sind häufig ausschlaggebend bei der Entscheidung, ob sich beispielsweise ein Betrieb in einer Region ansiedelt oder man sich als Einzelperson niederlässt. Vgl. hierzu ausführlicher: Puhan-Schulz 2005, S. 20.
[12] Vgl.: Wehrli-Schindler, Brigit: „Kulturelle Einrichtungen als Impulsgeber für Stadtentwicklung?“, in: http://www.nsl.ethz.ch/index.php/en/content/download/419/2707/file/, Stand 13.08.2007.
[13] Klein, Hans Joachim: „Vom Boom auf die Verliererstraße?“, in: Heinrichs, W. (Hrsg.): Macht Kultur Gewinn? Kulturbetrieb zwischen Nutzen und Profit, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997, S. 80.
[14] Vgl. hierzu und im Folgenden: Klein 1997, S. 80f.
[15] Vgl.: Puhan-Schulz 2005, S. 16ff.
[16] Wehrli-Schindler o.J.
[17] Vgl.: Kirchberg 2005, S. 99.
[18] Puhan-Schulz 2005, S. 27.
[19] Schäflein 1994, S. 139.
- Quote paper
- Katharina Lang (Author), 2007, Kulturelle Leuchttürme und ihre Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121818
Publish now - it's free



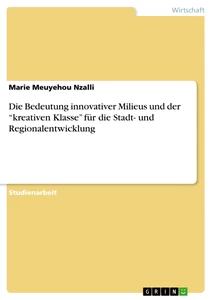

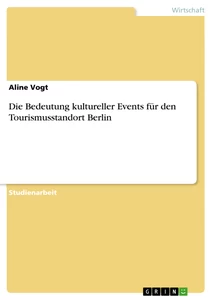
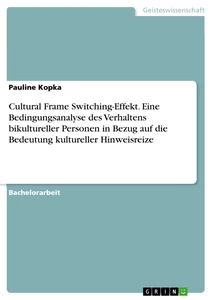
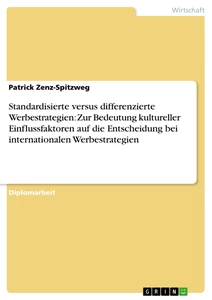
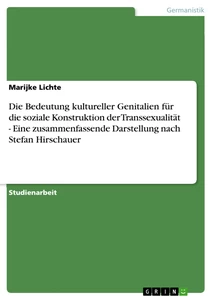

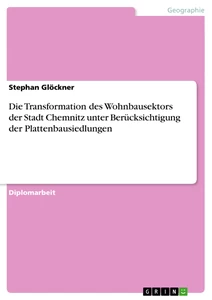
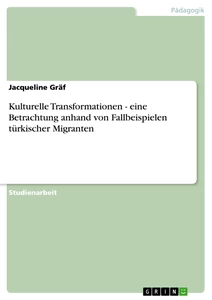


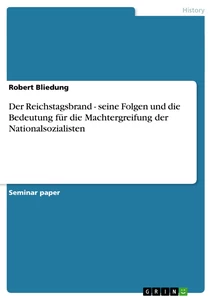
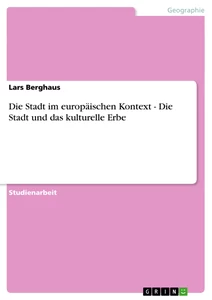
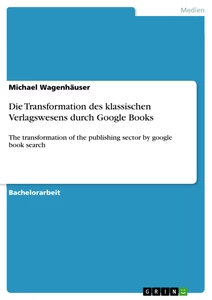
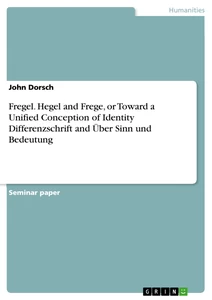

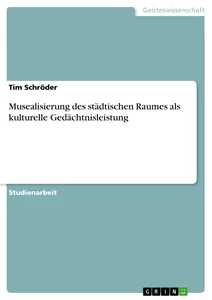
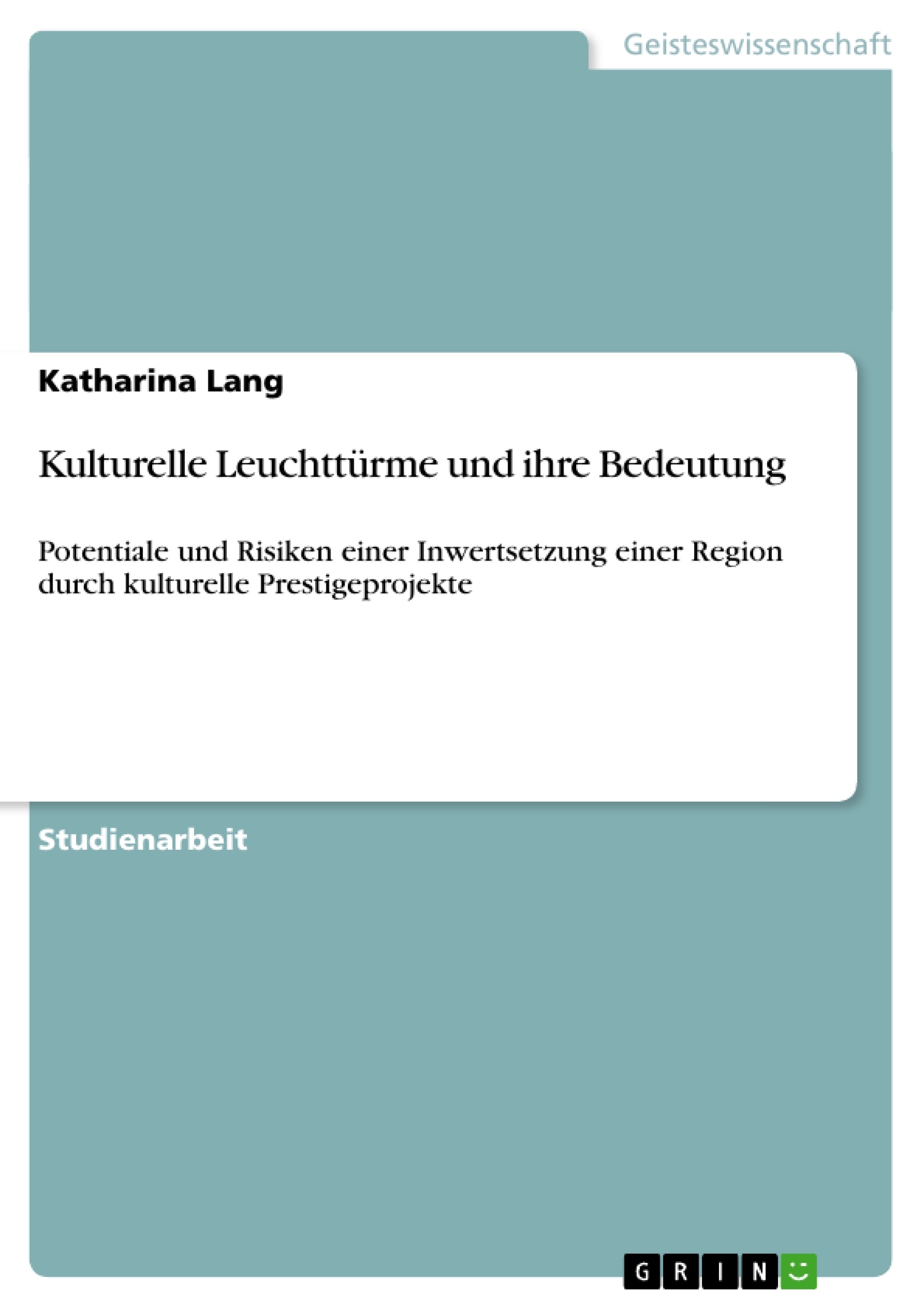

Comments