Leseprobe
INHALT
1 Einleitung
2 Die Prinzessin im traditionellen Märchen
2.1 Die Frau im Märchen
2.2 Die Prinzessin im Märchen
2.3 Gender und Rollenklischees
3 Das Märchenbilderbuch
3.1 Geschichte des Märchenbilderbuchs
3.2 Merkmale des Genres Märchenbilderbuch
3.3 Das neue Märchenbilderbuch
4 Figurenanalyse im Bilderbuch
4.1 Die literarische Figur
4.2 Figurendarstellung im Bilderbuch
4.3 Analysemodell
4.3.1 Figurenkonzeption
4.3.2 Figurencharakterisierung
4.3.3 Dynamik
5 Analyse
5.1 Nur die Schöne? - Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
5.1.1 Figurenkonzeption
5.1.2 Figurencharakterisierung
5.1.3 Dynamik
5.2 Ich will! - Die Prinzessin und die Erbse
5.2.1 Figurenkonzeption
5.2.2 Figurencharakterisierung
5.2.3 Dynamik
5.3 Die grausame Herrscherin - Der goldene Käfig oder die wahre Geschichte der Blutprinzessin
5.3.1 Figurenkonzeption
5.3.2 Figurencharakterisierung
5.3.3 Dynamik
6 Vergleich
6.1 Intertextuelle Referenz und Merkmale des neuen Märchenbilderbuchs
6.2 Charakterisierung: Figurenhandeln, Eigenschaften, Aussehen
6.3 Typisierung und Individualisierung
6.4 Die Prinzessinnen unter Betrachtung von Genderaspekten
6.5 Der Reifeprozess als gemeinsames Motiv
7 Fazit: Es waren einmal... drei individuelle Märchenprinzessinnen!
Literaturverzeichnis
1 EINLEITUNG
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien (Grimm/Grimm 2018, S. 29).
Die Prinzessin ist eine der wohl bekanntesten Märchenfiguren. Sie gilt - so wie hier die Königstochter aus Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich1 - als jung, schön, anständig und wartet sehnsüchtig auf den Märchenprinzen, der sie zur Frau nimmt und bis an ihr Lebensende glücklich macht (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 20). Die Prinzessin ist Rolle in dramatischen Verarbeitungen von Film bis Theater, dient als Kostümvorbild und Figur in Kinder- und Jugendliteratur (vgl. Wehse 1985, S. 17; Wehse 2002). Auch die gegenwärtigen, realen Prinzessinnen faszinieren - die Prinzessinnen der britischen, schwedischen und sonstiger Königshäuser zieren das Cover von Magazinen der Regenbogenpresse (vgl. Röhrich 2002, S. 114).
Da die Prinzessin bis heute als eine der wichtigsten identifikationsfiguren für Mädchen gilt (vgl. Heidtmann 2004, S. 62), stellt sich auch die Frage nach ihrer Abbildung im aktuellen Bilderbuch, welches als Träger gesellschaftlicher Diskurse Vorstellungen von Gender2 an Kinder vermittelt (vgl. Burghardt/Klenk 2016, S. 61). Wie wird die Prinzessinnenfigur im Märchenbilderbuch dargestellt?
um diese Frage zu beantworten, wird zunächst die Darstellung der Prinzessin und der Frau im traditionellen Märchen untersucht. Anschließend folgt ein Blick auf das Märchenbilderbuch, seine Geschichte und Merkmale, sowie neue Entwicklungen im Genre. Zur Analyse der Darstellung der Prinzessinnenfigur im Märchenbilderbuch wird ein auf Theorien und Modelle zur Figurenanalyse beruhendes Analysemodell entwickelt und anschließend auf drei Prinzessinnenfiguren ausgewählter neuer Märchenbilderbücher angewandt. Diese werden anschließend miteinander und mit der Darstellung der Prinzessin im klassischen Märchen verglichen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel zusammen.
2 DIE PRINZESSIN IM TRADITIONELLEN MÄRCHEN
Die Prinzessin ist nach wie vor eine der beliebtesten und populärsten Märchenfiguren und verkörpert als die Schöne oder sogar Schönste das bis heute wirkmächtigste Beispiel für Weiblichkeit und Tugend (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 20).
Für Kinder ist die Prinzessin nach wie vor eine relevante Identifikationsfigur. Nach einer Studie des Instituts für angewandte Kindermedienforschung (IfaK) zur Beliebtheit von Medienfiguren aus dem Jahr 2004 landet die Prinzessin als eine der beliebtesten Identifikationsfiguren für Mädchen auf dem dritten Platz (12 %) (vgl. Heidtmann 2004, S. 62).
Die Märchenforschung interessiert sich immer mehr für die Frau und damit auch die Prinzessin im Märchen, weshalb ihre Rolle inzwischen verstärkt untersucht wird (vgl. Röhrich 2002, S. 113).
2.1 Die Frau im Märchen
Betrachtet man die 211 Märchen der Brüder Grimm, so fällt auf, dass mehr als ein Drittel dieser Märchen weibliche Protagonistinnen haben. Auch die bekanntesten Märchen, zu denen unter anderem Aschenputtel, Dornröschen, Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich oder Rapunzel zählen, gehören dieser Gruppe an (vgl. Horn 1996, S. 355). Dieses Verhältnis ist darauf zurückzuführen, dass die Mehrzahl der Märchen durch Frauen erzählt und weitergegeben wurden (vgl. ebd.).
Die Frauenfigur im Märchen ist vielschichtig. Sie tritt im Märchen in den unterschiedlichsten sozialen und familiären Rollen auf: Sie ist Königin, Prinzessin oder Bedienstete, mal Schwester, Braut, Mutter, Kind oder Großmutter (vgl. Röhrich 2002, S. 114). Auch ihr Aussehen und ihre Eigenschaften variieren zwischen schön und hässlich, schlau und dumm, fleißig und faul, gierig und bescheiden (vgl. ebd.). Dominierende Eigenschaften der Frau im Märchen sind allerdings oft „ihre unbeirrbare Treue, ihre totale Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit, ihre Leidensfähigkeit und Durchhaltekraft“ (ebd.). Diese Attribute entscheiden den Ausgang des Märchens und sind die Eigenschaften, die von den Heldinnen gefordert werden, um Erlösung zu erfahren:
Die Frauen und Mädchen erreichen ihre Ziele dadurch, daß sie Leid ertragen [...]. Genauer gesagt werden sie gerade deswegen als Heldinnen erkannt und aufgrund ihres Leidens und ihrer Passivität belohnt (Lehnert 1996, S. 25).
Passive Heldinnen dieser Art in den grimmschen Märchen sind z.B. das Dornröschen, Schneewittchen oder auch Rotkäppchen, die wartend ausharren und so Erlösung und Glück erfahren (vgl. Rölleke 1985, S. 82). Jedoch findet sich auch ein entgegengesetzter, aktiver Typ Frau, der selbst tätig wird, um eine Situation zu meistern (vgl. ebd. S. 83). Als Beispiele in den Märchen der Brüder Grimm wären hier das Sterntalermädchen zu nennen, dass großzügig all ihr Hab und Gut verschenkt oder die Schwester aus Die sieben Raben, die durch ihre Handlungsfähigkeit ihre Brüder erlöst (vgl. ebd., S. 84). In russischen Märchen und auch in den Märchen aus Tausendundeine Nacht finden sich vermehrt selbstbewusste, individuelle, mutige und auch grausame Frauenfiguren (vgl. Röhrich 2002, S. 123; Wehse 2002). Auch existieren Frauenfiguren, die sich aus ihrer Passivität befreien und aktive Heldinnen des Märchens werden (vgl. Rölleke 1985, S. 84). Die zu Beginn des Märchens hilflos erscheinende Gretel in Hänsel und Gretel beispielsweise rettet in ihrer größten Not ihren Bruder und sich vor der Hexe und ist dabei tapfer, klug und raffiniert (vgl. Horn 1996, S. 357).
Viele Märchenheldinnen teilen hinsichtlich ihres Alters eine entscheidende Gemeinsamkeit: Sie befinden sich meistens in der Pubertät und durchlaufen im Märchen den Reifeprozess bis hin zur Heirat am Schluss des Märchens (vgl. Rölleke 1985, S. 82; Röhrich 2002, S. 116): Rapunzel wird als Zwölfjährige in den Turm gesperrt und dort geschwängert, und Dornröschen schläft an ihrem fünfzehnten Geburtstag ein und heiratet nach ihrem Erwachen den Prinzen, der sie durch den Kuss erlöst hat (vgl. Röhrich 2002, S. 116). In diesen Reifevorgängen findet für die Heldinnen des Märchens auch die Ablösung von den Eltern und das Ende ihrer Kindheit statt (vgl. Rölleke 1985, S. 82; Horn 1996, S. 357).
Die Frau im Märchen erscheint in den unterschiedlichsten Rollen und gesellschaftlichen Positionen. Dabei lassen sich sowohl abwartende als auch tatkräftige Figuren finden. Gemeinsames Merkmal der Märchenheldinnen ist ihr oft adoleszentes Alter.
2.2 Die Prinzessin im Märchen
Denkt man an die Frauen im Märchen wird einem als erstes wohl die Figur der Prinzessin einfallen, allerdings dominieren in der Märchenforschung die Beiträge, die eher die Frauenfigur oder die Heldin untersuchen, als die Prinzessin selbst (vgl. Wehse 1985, S. 9).
Bei der Prinzessin oder auch Königstochter als Figur des Volksmärchens handelt es sich wie für Volksmärchen üblich „nicht um einen individuell gezeichneten Charakter - worauf schon weitestgehendes Fehlen eines Namens hindeutet - sondern um eine stark typisierte Figur“ (ebd., S. 9). Diese Typisierung und Einfachheit lässt sich darauf zurückführen, dass das Märchen eine Gattung mit schematischen Handlungsmustern ist, in der sich die Funktion der Figuren allein durch ihre Rolle für die Geschichte ergibt (vgl. Martinez/Scheffel 2016, S. 151).
Die Prinzessinnen im Märchen bleiben in den meisten Fällen, im Gegensatz zum Prinzen, Prinzessinnen und sind in der Regel an den Königssohn gebunden (vgl. Wehse 1985, S. 9). Trotz der starken Typisierung kann nicht von der einen Prinzessin gesprochen werden; vielmehr lässt sich die Figur entsprechend ihrer verschiedenen Schicksale, Handlungen und Charaktereigenschaften in unterschiedlichste, teilweise gegensätzliche Gruppen einteilen (vgl. Wehse 2002). Die Prinzessin ist mal das Opfer, wird verzaubert oder entführt und in Gefangenschaft gehalten, mal muss sie lange Zeiten voller Leid ertragen oder wird gegen ihren Willen verheiratet (vgl. Wehse 1985, S. 11ff). Für die Prinzessin steht die Partnergewinnung im Mittelpunkt, weshalb die meisten Märchen mit Prinzessinnen als Protagonistinnen vordergründig von der Eroberung der Gunst und Hand der Prinzessin handeln (vgl. Wehse 1985, S. 11; Wehse 2002) Die glückliche Ehe ist das Ziel der Prinzessin:
Sie möchte den sicheren Hafen der Ehe erreichen, einen möglichst ehrbaren und angesehenen Ehemann im Adelsstand bekommen und mit diesem und den gemeinsamen Kindern glücklich sein, bis an das Lebensende (Rit- ter/Ritter 2013, S. 20).
Hinsichtlich der Figurencharakterisierung lassen sich gemeinsame Merkmale der Prinzessinnen im Märchen finden: Sie ist die, laut der für Märchen typischen stilisierte Beschreibungen, Schönste im ganzen Land (vgl. Wehse 1985, S. 10). Sie ist entweder ein Kind oder an der Grenze zur Pubertät und zeichnet sich zum Beispiel über eine durch goldene Haare symbolisierte Schönheit oder durch besondere Klugheit aus (vgl. Wehse 2002). Die Prinzessin ist „tugendhaft, demütig und möglichst passiv; und wenn dem nicht so ist, so lernt sie das im Laufe des Märchens“ (Rit- ter/Ritter 2013, S. 20). Sie bleibt eine weitestgehend passive und stark idealisierte Figur, die nur selten von diesem Typ abweicht (vgl. Wehse 2002).
Die Märchenforschung beweist allerdings auch, dass im Märchen durchaus Frauenfiguren und damit auch Königstöchter auftauchen, die nicht nur passiv auf ihren Märchenprinzen warten, sondern selbst aktiv werden (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 20).
Die Königstochter in Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich ist ein prominentes Beispiel für eine aktive Prinzessin (vgl. Rölleke 1985, S. 86). Im Laufe der Handlung lehnt sie sich gegen die Macht ihres Vaters und den aufdringlichen Frosch auf und wirft das Tier an die Wand: „[S]ie verwirft ihn in drastischster Form, schmettert ihn gegen die Wand, ermordet ihn brutal.“ (ebd.). Die Prinzessin ist den bürgerlichen Konventionen so lange gefolgt, wie sie es mit sich selbst vereinbaren kann, verwirft sie allerdings in einem emanzipatorischen Akt, als es um sie selbst geht (vgl. ebd., S. 86f). Das Märchen gibt ihr Recht und belohnt sie mit einem positiven Ausgang der Erzählung - der Ehe mit dem erlösten Königssohn (vgl. ebd.).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei der Prinzessin im Märchen um eine stark typisierte Figur handelt, die jedoch keinesfalls darauf reduziert werden darf, da ihr Schicksal von Märchen zu Märchen variiert. Das gemeinsame Ziel der schönen, eher passiven Prinzessinnen bleibt die glückliche Ehe. Vergleicht man die Prinzessin mit anderen Frauen im Märchen, erscheint die Prinzessin passiver als andere weibliche Figuren.
Das Bild der Frau im Märchen ist maßgeblich durch das Frauenbild des 19. Jahrhunderts geprägt (vgl. Röhrich 2002, S. 117). Daraus ergeben sich auch bestimmte Geschlechter- und Rollenklischees, die im Märchen vorherrschend sind und aus feministischen sichtweise kritisiert werden:
Die Geschlechterrollen-Erwartungen und der Rollenzwang im Märchen stamme aus der patriarchalischen Welt, wenn der Mann Heldentaten zu vollbringen und die Frau häufig eine dienende Rolle hat (ebd.).
Die Frauen im Märchen befinden sich meist in einer passiven Position und sind abhängig von der Rettung des Mannes (vgl. Lehnert 1996, S. 25). Aschenputtel gewinnt die Zueignung des Königssohns und wird von ihm vor der bösen Stiefmutter und den Schwestern gerettet; Dornröschen wartet schlafend auf die Erlösung durch den mutigen Königssohn (vgl. ebd.). Die Anweisung für Frauen und Mädchen ist eindeutig: „Ein schönes Mädchen hat nicht zu agieren, sondern zu warten, bis der Richtige vorbeikommt.“ (Röhrich 2002, S. 117). Für Opferbereitschaft und Gehorsamkeit werden sie vom Märchen belohnt (vgl. ebd., S. 119). Zu Passivität wird den Frauen im Märchen nicht nur geraten, sondern sie werden in einigen Fällen sogar für Aktivität bestraft:
Der Wunsch nach eigener, freier Partnerwahl wird der Prinzessin in König Drosselbart“ (KHM 52) als Hochmut ausgelegt. Sie [...] wird durch Demütigung zur Raison gebracht (ebd., S. 118).
Lehnert stellt fest, dass Märchen ein negatives Frauenbild vermitteln. Sie führt an, dass mehr böse Frauenfiguren als Männerfiguren existieren und Frauen viele negative Eigenschaften wie Hochmut, Egoismus oder Neid zugeschrieben werden. Außerdem werden zahlreiche Merkmale bei Frauen als negativ dargestellt, während sie bei Männern positiv gewertet oder weniger bestraft werden, z.B. Macht, Aktivität oder Grausamkeit. (vgl. Lehnert 1996, S. 34f).
Die Frauen im Märchen sind wiederholt männlicher Gewalt, Macht und Unterdrückung ausgesetzt (vgl. Röhrich 2002, S. 118). Außerdem finden sich gehäuft Frauen, die dem weiblichen Rollenklischee des 19. Jahrhunderts entsprechend, Hausarbeiten verrichten und dafür belohnt werden: Schneewittchen führt den Haushalt der sieben Zwerge und die Goldmarie in Frau Holle wird fürs Bettmachen und Putzen belohnt (vgl. Röhrich 2002, S. 117).
Ausnahmen von dem Klischee der passiven Frau und dem aktiven Mann gibt es dennoch, da im Märchen auch Figuren auftauchen, die dieses Klischee durchbrechen (vgl. Horn 1996, S. 359). Neben den in Kapitel 2.1 und 2.2 bereits erwähnten mutigen Märchenheldinnen wie der Prinzessin in Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich existieren weitere Frauenfiguren im Märchen, die sich aus ihrer Passivität befreien, wenn die Handlung es von ihnen verlangt (vgl. Röhrich 2002, S. 121). Dabei steht die Intelligenz der Frauen im Vordergrund:
Die unendlich geduldige, sich widerstandslos unterwerfende Frau ist nicht die Märchenheldin par excellence. Weibliche Klugheit z.B. ist ein variantenreiches Thema und Ausdruck einer Eigenständigkeit der Frau (ebd.).
Ein besonders interessantes Beispiel ist die persische Rätselprinzessin Turandot aus den Märchen von Tausendundeine Nacht (vgl. Schoeler/Mogtader 2017, S.16). Sie erscheint als grausame und brutale Prinzessin, die all die Freier, die um ihre Hand anhalten und ihre Rätsel nicht lösen können, enthaupten und deren Köpfe rund um ihr Schloss aufspießen lässt (vgl. ebd. S. 17). Sie gehört zu dem Typ Frauenfigur, die nur denjenigen als Ehemann akzeptieren, der sich als intelligent genug erweist (vgl. Röhrich 2002, S. 121). Eine ähnliche Version des Turandot-Märchens findet sich auch in den grimmschen Märchen unter dem Titel Das Meerhäschen.
Recherchiert man zu den Frauenfiguren im Märchen, dann fällt auf, dass die einzelnen Figuren und ihre Handlungen oft unterschiedlich gedeutet werden können. Die Prinzessin Turandot erscheint auf der einen Seite furchtlos und unabhängig, als eine „durch die Ästhetik des Bösen faszinierende, bis zum Exzeß (sic!) über den Mann herrschende Partnerin“ (Wehse 2002). Auf der anderen Seite spiegelt sich in ihrer Geschichte die gesellschaftliche Auffassung wider, dass eine Frau ihr Selbstbewusstsein verlieren und sich dem Mann beugen muss, um eine Ehe einzugehen (vgl. ebd.). Die grausame Turandot ist schlussendlich auch nicht die Heldin des Märchens, sondern der Freier, der sie für sich gewinnt (vgl. Rölleke 1985, S. 85).
Die Goldmarie verrichtet zwar brav die Hausarbeiten, jedoch zeichnet sich durch ihre Handlungen auch ab, dass sie weiß, wie man Probleme praktisch lösen kann (vgl. Röhrich 2002, S. 121). Aschenputtel wird zwar durch die Heirat aus ihrer unglücklichen Stellung befreit, allerdings ist sie keinesfalls die Frau, die untätig auf ihre Erlösung wartet: Auf dem Ball gelingt es ihr den Prinzen vollkommen von sich abhängig zu machen und führt ihn bis zum Schluss des Märchens an der Nase herum (vgl. ebd., S. 122).
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Frau im Märchen entsprechend der Entstehungszeit dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts folgt. Ihr Handeln ist in vielen Fällen auf das Ziel der glücklichen Ehe ausgerichtet. Allerdings lassen sich neben den passiven Frauen auch Figuren finden, die sich Rollenklischees widersetzen. Einzelne Märchenheldinnen haben oft mehrere Facetten, die betrachtet werden können, um Aussagen über die Erfüllung oder Verwerfung von Genderstereotypen zu treffen.
3 Das Märchenbilderbuch
Das Märchen gilt seit dem Erfolg der Kinder- und Hausmärchen von Wilhelm und Jakob Grimm als „die Gattung des jüngeren Kindes“ (Mattenklott 2005, S. 100) und ist heute in vielen Teilen der Welt ein fester Bestandteil der Kinderliteratur (vgl. Weinkauff 2014, S. 63).
Genauso genießen Märchenbilderbücher große Beliebtheit und „überschwemmen den Markt jedes Jahr aufs Neue“ (Mattenklott 2005, S. 101). Märchenbilderbücher und illustrierte Märchensammlungen sorgen dafür, dass die Märchentexte relevant bleiben und weiterhin rezipiert werden (vgl. Joosen 2018, S. 473).
3.1 Geschichte des Märchenbilderbuchs
Historisch betrachtet waren Illustrationen schon immer ein Bestandteil des Märchens. Nachdem die ersten Bände der Kinder- und Hausmärchen 1812 und 1815 durch die Brüder Grimm herausgegeben wurden, folgten 1819 erste Kupferstiche zur Ergänzung der Texte (vgl. Thiele 2005, S. 164).
Märchenillustrationen gewannen mit der wachsenden Popularität des Märchens immer mehr an Bedeutung, sodass das Märchenbilderbuch seit dem 19. Jahrhundert einem eigenen Genre angehört. (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 19; Mattenklott 2015, S. 337). Märchen und Bilderbuch stehen heutzutage in einem nicht mehr wegzudenken Bezug zueinander (vgl. Mattenklott 2005, S. 101).
Zu Beginn erschienen hauptsächlich bebilderte Märchenbücher; später aber auch speziell für ausgewählte Märchen hergestellte Bilderbücher (vgl. Ritter/Ritter 2013, S.19). Das heutige Angebot ist vielfältig und reicht von kitschiger bis hin zu anspruchsvoller bildlicher Verarbeitung - über Antimärchen der 70er-Jahre und Illustrationen mit stereotypen Disney-Filmfiguren (vgl. ebd.).
Die Bilderbuchkünstler*innen verarbeiten die Erzählungen und interpretieren in ihren Bildern vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und Konflikte den Märchenstoff immer wieder neu; dabei werden die bekannten Märchentexte verändert und an gegenwärtige Vorstellungen angepasst, ihnen widersprochen oder zugestimmt (vgl. Mattenklott 2015, S. 337).
3.2 Merkmale des Genres Märchenbilderbuch
Das Genre Märchenbilderbuch lässt sich in Subtypen gliedern: Joosen teilt ein in traditional tales, duplicates und postmodern rewritings (2018, S. 475).
Traditional tales sind die Märchenbilderbücher, die den ursprünglichen Märchentext ohne besondere Veränderungen des Inhalts oder Stils übernehmen (vgl. ebd.). Als duplicates lassen sich die Märchenbilderbücher bezeichnen, in denen der Märchentext z.B. verkürzt oder angepasst wird - beruhend darauf, was Erwachsene für Kinder als geeignet empfinden (vgl. ebd.).
Postmodern Rewritings meint Märchenbilderbücher, in denen die Autor*innen und Illustrator*innen den ursprünglichen Märchentext verändern und mit Bild und Text experimentieren. Sie schreiben z.B. Figuren um, verwenden verschiedenste Techniken und Zeichenstile oder parodieren und erzählen die traditionellen Märchentexte neu (vgl. ebd., S. 482).
Die verschiedenen Arten der Verarbeitung haben das klassische Volksmärchen als gemeinsame Grundlage. Das Märchen stammt aufgrund seiner nachträglichen schriftlichen Fixierung durch Märchensammler „aus einer narrativen Tradition der Mündlichkeit“ (Ritter/Ritter 2013, S. 19). Die Merkmale des Märchens, wie die Eindimensionalität der Handlung, die typisierten Figuren und der abstrakt-formelhafte Stil, lassen sich auf diese mündliche Überlieferung zurückführen (vgl. ebd.).
Neben diesen typischen Eigenschaften des Märchens weist die Gattung auch eine stark bildhafte Sprache auf, die an die Vorstellungskraft der Rezipient*innen appelliert (vgl. ebd.). Diese Bildhaftigkeit erzeugt das Spannungsfeld zwischen Märchen und Bilderbuch: Das Märchenbilderbuch tritt in Konkurrenz zum Märchentext, da es dort Bilder einfügt, wo der Rezipient ursprünglich Eigene kreieren sollte (vgl. Thiele 2005, S. 165).
Dieses spannungsreiche Verhältnis wird insofern zum Merkmal des Märchenbilderbuchs, als dass es das Genre zu einem sich stetig verändernden und äußerst vielseitigen macht. Die Bilderbuchkünstler*innen spielen immer wieder mit dem klassischen Märchenstoff; ihre Bilder gehen über eine dem Text dienende Rolle hinaus (vgl. Thiele 2005, S. 182f). Daraus ergibt sich die Betrachtung von Märchenbilderbüchern als aktive Auseinandersetzung mit dem Märchentext und den Vorstellungen der gegenwärtigen Gesellschaft:
Wer Märchen als kulturelle Erzählangebote betrachtet, die eine Gesellschaft nach ihren jeweiligen Werten und Bedürfnissen immer neu und anders bewertet, wird dagegen in der Vielfalt bildnerischer Annäherungen die Chance zu einer dynamischen Auseinandersetzung mit dem historischen Erzählmaterial sehen (ebd., S. 183).
Nikolajeva und Scott stellen fest, dass die Bilder in Märchenbilderbüchern nicht nur den Stil der Künstlerinnen und ihre Interpretation der Geschichte widerspiegeln, sondern auch gleichzeitig den gegenwärtig modernen Zeichenstil, pädagogische Intentionen, Ideologien und aktuelle gesellschaftliche Sichtweisen (vgl. 2006, S. 42).
Die Befürchtung, dass Märchenbilderbuch würde die Vorstellungskraft einschränken, ist unbegründet. Die Bilder in Märchenbilderbüchern öffnen den Text für neue und alternative Betrachtungs- und Interpretationsweisen, im Zusammenwirken entfaltet sich das Verhältnis von Bild und Text im Märchen immer wieder aufs Neue (vgl. Thiele 2005, S. 183; Joosen 2018, S. 475).
3.3 DAS NEUE MÄRCHENBILDERBUCH
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zeigen die verstärkten Emanzipationsbemühungen der Bilderbuchkünstler*innen; sie entfernen sich nach und nach vom pädagogischen Anspruch, der an das Bilderbuch gestellt wird, und entwickeln es zu einem literarästhetischen Erfahrungsmedium (vgl. Thiele 2005, S. 167). Diese Entwicklung hat das neue Bilderbuch hinsichtlich des Formats, der Gestaltung von Bild und Text, Erzählformen und der Bild-Text-Beziehung verändert (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 20). Das hat Auswirkungen auf das Genre des Märchenbilderbuchs: „In diesem Zusammenhang sind auch die klassischen Volksmärchen als literarischer Stoff neu entdeckt worden.“ (ebd.).
Sowohl die Bebilderung im klassischen Sinne als auch eine verstärkte Fragmentierung sind im Bereich der Märchenillustration zu beobachten und haben das Märchen verändert (vgl. Thiele 2005, S. 181). Die aktuellen Entgrenzungstendenzen sind nicht unkritisch zu betrachten, da sie mit dem Risiko einer Beliebigkeit verbunden sein können (vgl. ebd., S. 182), spiegeln aber gleichzeitig gesellschaftliche Tendenzen der Gegenwart wider (vgl. Joosen 2018, S. 477).
Die Künstler*innen aktueller Märchenbilderbücher spielen mit der Inszenierung des Stoffes und brechen mit Vorstellungen - sie transformieren die traditionellen Volksmärchen in „bildgewordene Reflexionen oder [...] Reflexionen auslösende Verbildlichungen“ (Tabbert 2006, S. 125). Das Märchen wird neu inszeniert und im Sinne „einer subjektiven und dem Zeitgeist verpflichteten“ (Mattenklott 2005, S. 101) Darstellung neu interpretiert. Die Neuinterpretationen sind vielseitig:
Das postmoderne Bilderbuch erweist sich [...] mit Blick auf die Märchenillustration als äußerst innovatives Experimentierfeld mit hybriden und offenen Adressatkonzeptionen, dem virtuosen Spiel mit intertextuellen Referenzen, fantasievollen Bild-Text-Konstruktionen und kunstvollen Perspektivwechseln (Schmideler 2016, S. 9).
Das postmoderne Märchenbilderbuch setzt sich auch mit dem Thema Rollenklischees auseinander. Während das traditionelle Märchen in der Regel den Genderstereotyp der schönen und untätigen Märchenheldin abbilden und Märchenverfilmungen - z.B. die von Walt Disney - diesen Stereotyp weiter reproduzieren (vgl. Lehnert 1996, S. 82), lassen sich im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen von Geschlechterrollen auch entsprechende Entwicklungen in der postmodernen Kinder- und Jugendliteratur erkennen (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 20). Prota- gonistinnen in aktueller Kinder- und Jugendliteratur haben heute Eigenschaften, die in einem traditionellen Verständnis eher männlichen Protagonisten zugesprochen wurden (vgl. ebd.).
Entsprechende Veränderungen lassen sich auch im Märchengenre beobachten: Über neu zusammengestellte Märchensammlungen, umgeschriebene und neu kreierte Märchen, die intelligente, selbstbewusste und selbstbestimmte Heldinnen als Protagonistinnen haben, sollen Klischees und Stereotype aufgebrochen werden (vgl. Lehnert 1996, S. 85).
Neue Märchenbilderbücher bewegen sich hier zwischen den romantischen Rollenklischees des traditionellen Märchens und gesellschaftlichen Umdeutungen von Genderstereotypen in Kinder- und Jugendliteratur (vgl. Ritter/Ritter 2013, S. 21) und haben vor dem Hintergrund postmoderner Entwicklungstendenzen das Potenzial einer „Neubestimmung klassischer Märchenstereotype“ (ebd., S. 26).
4 Figurenanalyse im Bilderbuch
In diesem Kapitel wird mit Rückgriff auf Theorien und Modelle der Figurenanalyse aus der Erzähltext-, Bilderbuch- und Filmanalyse ein Analysemodell erarbeitet, anhand dessen die Prinzessinnen in drei ausgewählten Bilderbüchern analysiert werden. Die Erarbeitung erfolgt unter der besonderen Berücksichtigung der Figurendarstellung im Bilderbuch.
Figuren sind die „Bewohner der fiktiven Welten fiktionaler Erzählungen“ (Schef- fel/Martinez 2016, S. 147). Wichtiges Merkmal der literarischen Figur ist, dass man ihr „Intentionalität, also mentale Zustände (Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten) zuschreiben können muss“ (ebd.). Figuren sind grundlegend für eine Erzählung, da sie die zentralen Handlungsträger sind und durch ihr Tun den Fortgang der Handlung beeinflussen (vgl. Kurwinkel 2017, S. 86). Figuren können dabei menschlich oder nichtmenschlich sein (vgl. ebd.).
Um die literarische Figur analysieren zu können, müssen alle über sie gegebenen informationen betrachtet werden: Wie sie handelt, in welcher Beziehung sie zu den anderen Figuren steht und welche Entwicklung sie in der Erzählung durchläuft (vgl. Bachorz 2004, S. 65f).
Auch wenn im Folgenden ein eigenes Analysemodell entwickelt wird, dass die Figurenanalyse in Kategorien einteilt, muss erwähnt werden, dass Autoren, die sich mit der Figurenanalyse beschäftigen, immer wieder andere Einteilungen vornehmen. Das zeigt, dass die einzelnen Elemente, die eine Figur charakterisieren, sich gegenseitig bedingen und in ihrem Zusammenspiel die Figur entstehen lassen.
4.2 Figurendarstellung im Bilderbuch
Die größte Besonderheit der Figurendarstellung im Bilderbuch ist, dass die Figur nicht allein durch den Schrifttext, sondern genauso durch den Bildtext charakterisiert wird (vgl. Nikolajeva/Scott 2006, S. 82; Kurwinkel 2017, S. 89).
Figuren im Bilderbuch werden nach Staigers Fünfdimensionalen Modell der Bilderbuchanalyse auf der Ebene der Bildlichen Dimension durch z.B. Kleidung und Mimik charakterisiert, und in der Verbalen Dimension durch den Erzähler oder andere Figuren (vgl. Staiger 2014, S. 16). Darüber hinaus lassen sich aus der Figurenkonzeption und -konstellation, dem Raum in der Narrative Dimension und dem Verhältnis von Bild und Text in der Intermodalen Dimension weitere Informationen über die Figur gewinnen (vgl. ebd., S. 14ff).
Im Bild können Figuren z.B. über Farben, Formen oder die Bildkomposition charakterisiert werden (vgl. Kurwinkel 2017, S. 89). Die Körperhaltung, Gestik und Mimik geben Aufschluss über Emotionen und Einstellungen der Figur (vgl. Niko- lajeva/Scott 2006, S. 82f). Die Größe der Figur und ihre Positionierung können anzeigen, in welchem Verhältnis eine Figur zu den anderen Figuren steht - oder Charakterveränderungen markieren (vgl. Nikolajeva/Scott 2006, S. 83). Das Verständnis für solche Bildbestandteile beruht auf gesellschaftlichen Konventionen, weshalb Annahmen darüber keinen Regeln unterliegen (vgl. ebd.).
Im Bilderbuch kann die Figur sowohl verbal über den Text als auch visuell über die Bilder beschrieben werden. Das Bild-Text-Verhältnis kann sich dabei ergänzen oder widersprechen (vgl. ebd.). Für die Bilderbuchanalyse, auch in Bezug auf die Darstellung der Figur, gilt also „die verschiedenen Formen der narrativen Informationsvergabe in Bild und Schrifttext zu erfassen und ihr Zusammenwirken beim Aufbau eine erzählten Welt zu beschreiben“ (Staiger 2014, S. 15).
4.3 Analysemodell
Das Analysemodell fokussiert sich auf drei Kategorien: Figurenkonzeption, Figurencharakterisierung und Dynamik. Die Dynamik ist stark mit der Komplexität der Figur verknüpft und wird deshalb in der Regel mit ihr zusammen unter dem Punkt der Figurenkonzeption gefasst (vgl. Scheffel/Martinez 2016, S. 151). In diesem Analysemodell erhält die Dynamik, aufgrund der zu analysierenden Figur, eine eigene Kategorie. Bei der traditionellen Prinzessin handelt es sich in den meisten Fällen um eine typisierte, statische Figur (vgl. Kapitel 2.2). Um analysieren zu können, inwiefern die Prinzessinnen in neuen Märchenbilderbüchern diesem Typ entsprechen, ist eine genaue Untersuchung ihrer Entwicklungsdynamik notwendig.
4.3.1 Figurenkonzeption
Die Figurenkonzeption ist das „anthropologische Modell, das der [...] Figur zugrunde liegt“ (Pfister 1977, S. 240). Zur Analyse der Konzeption lassen sich die Dominanz der Figur, ihre Stellung in der Figurenkonstellation und ihre Komplexität untersuchen (vgl. Kurwinkel 2017, S. 86).
Je nachdem wie Figuren in Erzählungen dargestellt sind und welche Funktion sie für den Fortlauf der Handlung einnehmen, können sie nach ihrer Dominanz in Haupt- oder Nebenfiguren eingeteilt werden (vgl. ebd., S. 87). Nebenfiguren erfüllen einen eher dienlichen Zweck (vgl. ebd.). Die Hauptfigur ist die zentrale Figur der Erzählung und oft der heldenhafte Protagonist, der gleichzeitig zur Identifikation anregt (vgl. ebd.). Dem Protagonisten gegenüber steht der Antagonist, der „als Kontrast zu diesem konzipiert“ (vgl. ebd.) ist. Protagonist und Antagonist entsprechen dem Subjekt und Opponent oder Gegenspieler im Handlungsmodell von Grei- mas (vgl. Bachorz 2004, S. 54). In diesem Modell wird das Objekt als die begehrte Person, ein Gefühl oder Gegenstand hinzugefügt (vgl. ebd.).
Um eine Figur analysieren zu können, ist „die genaue Bestimmung der Position der Figur im Zusammenhang mit anderen Figuren im Text unentbehrlich“ (ebd. S. 57). Die Erzählung gibt dabei die Konstellation vor, allerdings wird ihre Bedeutung erst durch das Wissen der Rezipient*innen vollständig erschlossen, wobei auch die Täuschung des Lesenden bewusst eingesetzt wird (vgl. ebd.). Bachorz unterscheidet zwischen Paarkonstellationen und Dreieckskonstellationen als die zwei zentralen Typen von Figurenkonstellation. In der Paarkonstellation findet sich das klassische Kontrastpaar von Gut und Böse und das Korrespondenzpaar als sich ergänzende Konstellation (vgl. ebd.).
Figuren können hinsichtlich ihrer Komplexität unterschiedlich konzipiert sein. Forster unterscheidet hier zwischen flat und round characters (vgl. Forster 1977, S. 73). Flat characters sind die Figuren, die auf eine Eigenschaft reduziert, für den Leser sehr greifbar sind und keinerlei Entwicklung durchlaufen (vgl. Bachorz 2004, S. 57). Round characters dagegen haben mehr als eine Eigenschaft, sie sind überraschend und verändern sich im Laufe der Erzählung (vgl. Kurwinkel 2017, S. 88). Je mehr Merkmale Figuren aufweisen, desto komplexer erscheinen sie:
Eine Figur kann mehr oder weniger komplex sein: Ein kleiner Merkmalssatz macht sie <flach> oder einfach, eine Vielzahl und Vielfalt von Wesenszügen <rund> oder <komplex> (Scheffel/Martinez 2016, S. 151).
[...]
1 Im Folgenden beziehe ich mich bei der beispielhaften Nennung von Märchentitel und -inhalten aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm auf die 7. Ausgabe „letzter Hand“ (1857).
2 Der Begriff Gender (engl.) bezeichnet - in Abgrenzung zum Begriff Sex (engl.) für das biologische Geschlecht - das soziale Geschlecht, welches als Produkt sozialer und kultureller Prozesse verstanden werden kann (vgl. Geimer 2013).
- Arbeit zitieren
- Merle Lotter (Autor:in), 2020, Die Darstellung der Prinzessinnenfigur im Märchenbilderbuch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035242
Kostenlos Autor werden

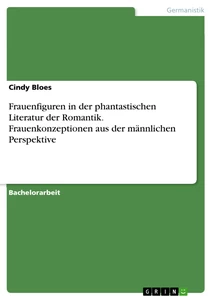
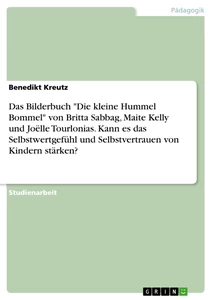
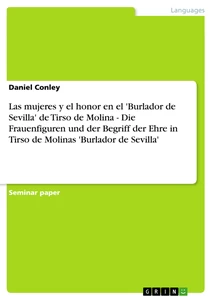
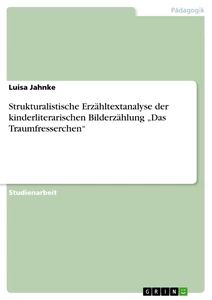

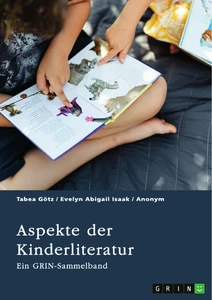
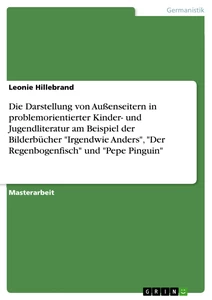

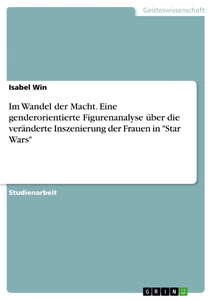


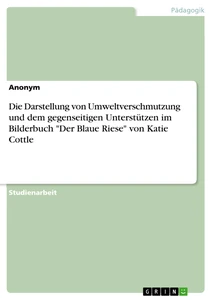


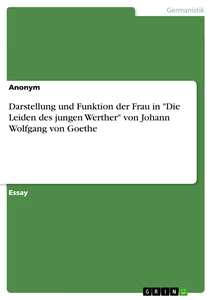

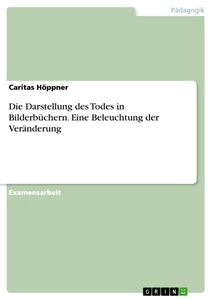


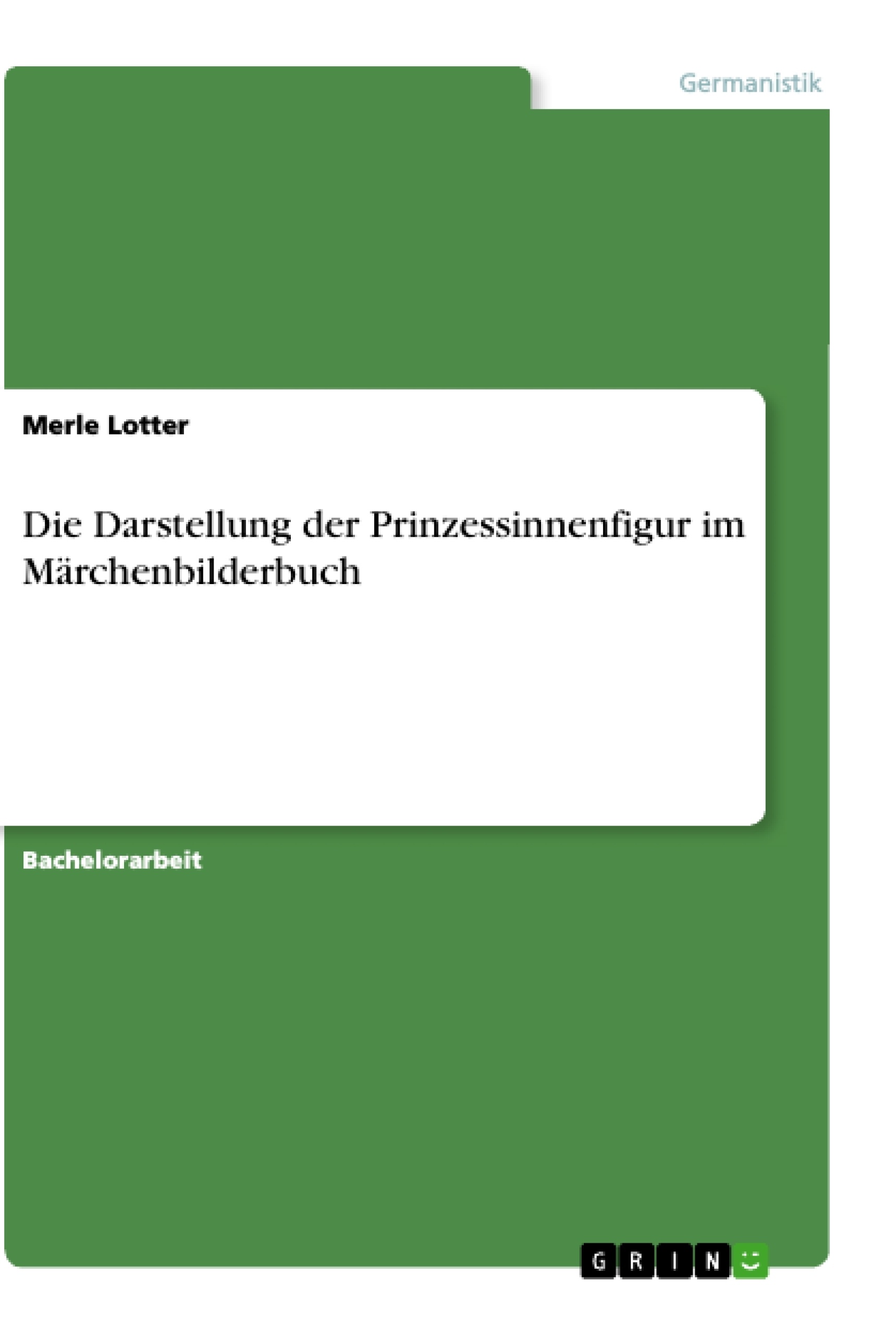

Kommentare