Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ethnizitätsdiskurs
2.1 Foucaults ‘Ordnung des Diskurses’
2.2 Definition von ‘Ethnizität’
2.3 Primordialismus
2.4 Situationalismus
2.5 Rational Choice Theory
2.6 Ethnizität als Kognition
3 Ethnogense der Roma
3.1 Roma-Ethnizität oder Roma-Ethnizitäten?
3.2 Sprache und Migration
3.3 Traditionen – Rromanipen
3.3.1 Romani butji (Arbeit)
3.3.2 Familie und Gesellschaft
3.3.3 Rituelle Reinheit
3.3.4 Das Romagericht ‘Kris’
3.3.5 Taufe, Heirat, Tod und Geisterglaube
3.3.6 Geschlechtertrollen – Ehre und Schande
3.4 Wir und sie
4 Roma in der Schweiz
4.1 Jenische und Roma
4.2 Geschichte und Identitätskonstruktion der Schweizer Roma
5 Zusammenfassung und theoretische Einbettung
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Der öffentliche Diskurs[1] über die Roma ist von stark pejorativen Stereotypen dominiert: Sie werden als Bettler und Kriminelle dargestellt, die am Rande der Gesellschaft leben und sich nicht integrieren wollen. Hervorgerufen werden die abwertenden Stereotype durch negative Medienberichte, die öffentliche Präsenz von vorwiegend armen und nicht integeren Roma und dem Unvermögen der Öffentlichkeit, einem differenzierten Ethnizitäts-Bild gerecht zu werden. Es existieren aber durchaus, vor allem historisch betrachtet, auch positive Stereotype, wie sie etwa von Emir Kusturica in seinen Filmen, die von Lebensenergie, Humor und Herz sprühenden Roma bevölkert werden, evoziert werden2.
Ein grosser Teil der in der Schweiz lebenden Roma, etwa 30'000, stammt laut Becker (2003) aus Südosteuropa, von wo sie wegen der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre flüchteten. Bolliger (2002) spricht dagegen von 30’000-40’000 mehrheitlich schon langjährig ansässigen Roma, die seit dem 2. Weltkrieg als Gastarbeiter aus Osteuropa in die Schweiz migrierten und hier integriert leben. Hämmerli (1985) sieht die in der Schweiz beheimateten Roma primär als Jenische und Manush. Die unterschiedlichen Aussagen zeigen, wie wenig man über die in der Schweiz lebenden Roma weiss.
Die Unklarheit zeigt aber auch, dass Vorstellungen über eine Bevölkerungsgruppe wie die Roma, im Sinne Foucaults (1979/2010), als ‘Diskurs’ aufgefasst werden sollten. Hinter den verschiedenen Meinungen und Darstellungen, was die Roma als ethnische Gruppe ausmacht, stehen Akteure mit verschiedenen Absichten und Wissensständen. Sie alle tragen zur Formierung des öffentlichen Bildes resp. Diskurses der Roma bei. Was für Auswirkungen hat dieser öffentliche Diskurs über die Roma auf diese selbst? Wer sind die Akteure, die Wissen über die Roma verbreiten und damit ihr öffentliches Bild formen? Wer hat die Möglichkeit, als Diskursautor zu fungieren und welche Stimmen bleiben ungehört? Was sind Diskrepanzen zwischen dem Fremdbild der Roma und ihrem Selbstbild? Diesen Fragen soll im Folgenden genauer nachgegangen werden.
Dazu werde ich in einem ersten Teil Foucaults Idee der Diskursformation und darauf aufbauend, die aktuellen theoretischen Debatten über Ethnizität (Primordialismus, Situationalismus, Rational Choice Theory etc.) kritisch behandeln, um in einem weiteren Schritt die Konstituierung der Roma-Ethnizität, im Besonderen in der Schweiz, genauer zu untersuchen. Da dies nur unter Einbezug von Geschichte, Sprache, Traditionen und Lebensalltag der Roma beantwortet werden kann, werde ich bei der Ausarbeitung diese verschiedenen Pfeiler berücksichtigen.
Die Literatur zur aktuellen Situation der Roma in der Schweiz ist sehr dürftig. Dies hat u.a. damit zu tun, dass viele die Öffentlichkeit scheuen und Repressionen und Benachteiligungen fürchten. Im Sinne der postmodernen Ethnologie (Barrett 1996) muss sich die Frage gestellt werden, in wie fern diese Arbeit der Wirklichkeit gerecht werden kann, da die Quellenlage nach wie vor ungenügend ist und die Aussagen der Autoren nicht empirisch überprüft werden können. Diese Arbeit sollte darum als Untersuchung gesehen werden, die die Konstruktion der Romaidentität – im Sinne eines Diskurses – durch Wissenschaftler und Romaintellektuelle erörtert. Sie ist daher als eine publizistische Sichtweise auf die Ethnizität der Roma zu sehen, die nur eine Annäherung an die Realität darstellen kann.
2 Ethnizitätsdiskurs
2.1 Foucaults ‘Ordnung des Diskurses’
Foucault (1970/2010) spricht in die ‘Ordnung des Diskurses’ über die verschiedenen Akteure, Mechanismen und Prozeduren, die Diskurse emittieren, formen und modifizieren. Er gibt zu Beginn aber keine Definition, was genau er mit ‘Diskurs’ meint. Er tut dies paradoxerweise gegen Ende des Textes, in dem er darauf hinweist, dass er in Zukunft die Sprechverbote der Sexualität vom 16. bis 19. Jahrhundert oder die Entstehung der Wissenschaft des Blicks, der Beobachtung und Feststellung während des Übergangs vom 16. zum 17. Jahrhundert untersuchen möchte (Foucault 1970/2010:39–40). Foucault meint daher mit ‘Diskurs’ die Organisation und Formierung von Wissensbeständen, als auch die Entstehung öffentlicher Ansichten und Praktiken, die sich aufgrund bestimmter Bedingungen und Handlungsweisen herausbilden. In ‘Die Archäologie des Wissens’ (Foucault 1969/2007:74) definiert er Diskurs allgemeiner als die Gesamtheit der Praktiken, die systematisch jene Gegenstände bilden, von denen sie selber sprechen. Diskurse sind daher reflexive Gebilde, die durch ihre Entstehung auf die Realität zurückwirken und sie verändern. Diskurse haben zudem verschiedene Autoren und werden durch Aushandlungsprozesse geformt und kontinuierlich verändert.
Foucault (1970/2010) spricht von drei Ausschliessungsmechanismen, die die Produktion von Diskursen kanalisieren und bestimmen. Es sind dies das Verbot über bestimmte Dinge zu sprechen (vornehmlich die Politik und Sexualität), der Wille zur Wahrheit (die Unterscheidung von wahr und falsch) und die Ausschliessung resp. Ablehnung des Wahnsinnigen zugunsten der Rationalität. Diese drei Ausschliessungssysteme sind gleichzeitig Mittel zur Autorisierung des Diskurses, damit dieser für sich den Mantel der Glaubhaftigkeit beanspruchen kann. Das Ringen um den wahren Diskurs – resp. die Macht als Autor eines Diskurses fungieren zu können – ist nach Foucault immer auch das Streben nach Macht.
Dann nennt Foucault drei interne Prozeduren, die als Klassifikations- Anordnungs- und Verteilungsprinzipien des Diskurses fungieren. Es sind dies der Kommentar, der Autor und die Disziplin. Durch den Kommentar wird der Diskurs in Primär- und Sekundärtexte untereilt. Der ursprüngliche Diskurs nimmt dabei die Rolle des Primärtextes ein, der Kommentar die des Sekundärtextes. Dadurch kommt diesem die Eigenschaft zu, schon Gesagtes zu wiederholen und daran anschliessend, zu kritisieren. Der Kommentar hat daher durch seinen Wiederholungscharakter die Funktion, Zufälligkeiten und Mehrdeutigkeiten zu reduzieren.
Der Autor bezeichnet in Foucaults Vorstellung ein Akteur, der Diskurse gruppiert, ordnet und emittiert. Diskurse sind immer an Autoren gebunden, die sie formen und als Sinnstifter dieser auftreten. Ihre Autorschaft ist aber nicht immer gleich stark gezeichnet und erwünscht. Manche Diskurse sollen bewusst ohne Verfasser erscheinen. Das Prinzip des Autors, von dem man Sinnzuweisung zu seinem Diskurs erwartet, steht dem Prinzip der Disziplin gegenüber.
Die Disziplin definiert sich durch einen Bereich von Gegenständen und Methoden. Sie setzt ihre Grenzen und gewinnt ihre Glaubwürdigkeit durch eine permanente Reaktualisierung der Regeln, die sie definiert. Damit eine Aussage Teil einer Disziplin werden kann, muss sie sich deren Sprache und Methoden bedienen, sich auf bestehende Diskurse beziehen und sich im Bezug zu ihnen einordnen. Erst dadurch gewinnt eine Aussage Glaubwürdigkeit. Disziplinen bestehen neben Wahrheiten immer auch aus Irrtümern, die eine konstituierende Rolle in der Formation von Diskursen spielen.
Neben den Ausschliessungsmechanismen und internen Prozeduren der Diskurse nennt Foucault ein drittes System von Prinzipien, mit dem Ziel der Verknappung der sprechenden Subjekte. Es sind dies das Ritual, die Diskursgesellschaften und die Doktrin. Das Ritual definiert die Qualifikation, die Gesten und Ausdrucksweisen (die Form), die ein sprechendes Subjekt verwenden muss, um als Autor eines Diskurses fungieren zu können. Zudem werden Diskurse von Diskursgemeinschaften verbreitet, die die Aussendung auf einen bestimmten Raum beschränken und nach bestimmten Regeln von sich gehen lassen. Die Autorschaft eines Diskurses darf dabei nicht verloren gehen. Die Doktrin beschränkt die Anzahl von Autoren einer Diskursgemeinschaft und ebenfalls die Rezipienten, die einen Diskurs vernehmen. Sie zwingt den Sprechern Aussagetypen auf, an die sie sich zu halten haben. Um Teil eines Diskursensembles zu sein, muss ein Subjekt gewisse Regeln und Wahrheiten anerkennen. Dadurch wird es in die Gemeinschaft eingebunden und gleichzeitig von Aussenstehenden abgegrenzt.
Die genannten Prinzipien der Ausschliessung, der internen Prozeduren und der Verknappung haben neben dem scheinbar positiven Effekt der Ordnung der Diskurse, die negative Auswirkung der Beschneidung und Verknappung ihres Zugangs, ihrer Wirkung als auch Bedeutung. Im Folgenden werde ich mich auf die Rolle der internen Prozeduren – also des Kommentars, des Autors und der Disziplin, bei der Konstituierung des Roma-Diskurses konzentrieren. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, möchte ich untersuchen, wie die Romaidentität von Autoren konstruiert wird und was für Dynamiken und Auswirkungen mit dieser Diskursformation einhergehen.
2.2 Definition von ‘Ethnizität’
Orywal/Hackstein (1993) definieren ethnische Gruppen als „endogame Gruppen, die mittels selektierter Traditionen ein sie abgrenzendes Selbstverständnis postulieren“ (Orywal/Hackstein 1993:398). Zu den selektierten Traditionen gehören eine gemeinsame Geschichte, Sprache, Religion, Deszendenz, Wirtschaftsweise, Physiognomie und eventuell ein eigenes Territorium.
Jenkins (1996) betont die soziale Einbettung von Identität, die reziprok (Selbstverständnis und Fremdsicht) ausgehandelt wird und sich in verschiedensten Formen wie Pass, persönlichem Verhalten, materiellen Attributen etc. äussert. Dies ist eine Definition wie sie Bentley (1987) anstrebt, der Ethnizität als persönliche Handlungsweisen interpretiert. Ethnizität ist demnach die soziale Alltagspraxis menschlichen Verhaltens, die zwischen individuellen Ansichten und Vorlieben, und deren der Gruppe, oszilliert.
Schermerhorn (1996) definiert eine ethnische Gruppe als Minorität in einer Mehrheitsgesellschaft einer anderen Ethnie und stellt sie damit mit Minorität gleich. Eriksen (1996) relativiert diese Definition und stellt fest, dass Mehrheiten eines Landes genauso als Ethnie bezeichnet werden können.
Hutchinson/Smith (1996:4–5) stellen fest, dass es keine Übereinstimmung in der Definition von Ethnizität gibt. Der Begriff taucht das erste Mal in den 1950er Jahren auf und wird mehrdeutig verwendet, von der Bezeichnung der ‘Essenz einer ethnischen Gruppe’ über die ‘Zugehörigkeit zu einer Gruppe’ im Kontext von konkurrierenden Gruppen bis hin zur Klassifizierung von Menschen im Kontext von Fremd- und Selbstwahrnehmung.
2.3 Primordialismus
Der primordialistische Ansatz, nach Geertz (1963/1996), beruht auf dem Glauben, dass ethnische Zugehörigkeit über die Geburt in eine ethnische Gruppe mit einer spezifischen Sprache, Kultur, sozialen Interaktion etc. geschieht. Der klassische Primordialimus geht damit von einem statischen Ethnizitätsbegriff aus. Geertz (1963/1996) betont die Signifikanz von ethnischen Charakteristika in Konfliktsituationen: So gewinnen fiktive oder reale verwandtschaftliche Bande, Rasse, Sprache, Religion, Region und Bräuche einer ethnischen Gruppe besonders in Konfliktsituationen an Bedeutung, da sie die Möglichkeit zur Abgrenzung geben.
Iscaacs (1975) betont die Prägung des Neugeborenen durch die Charakteristiken der Gruppe, in die es geboren wird. Es erhält ein Name, erlernt die Sprache, Geschichte, Religion und Kultur der Gruppe, wird mit spezifischen Werten ausgestattet, die ihm Wertschätzung innerhalb der Gruppe ermöglichen, die diese Werte teilen. Die Funktion von Gruppenidentitäten liegt bei dieser Betrachtungsweise in der Generierung von Zugehörigkeit und Selbstachtung. Das Ansehen einer Gruppe kann in einem multiethnischen Staat kleiner oder höher sein, kann daher mehr von der Selbst- oder der Fremdsicht geprägt sein. Isaacs (1975) vergleicht die ethnische Gruppe mit einer organischen Zelle, die aus unterschiedlichsten Bestandteilen besteht, die aber auf einen Kern ausgerichtet sind und auf verändernde Umweltbedingungen reagieren. Er vertritt daher einen prozessualen, transformativen Primordialismus.
Glazer/Moynihan (1963/1996) interessieren sich für den Primordialismus im Kontext von multiethnischer Vergemeinschaftung. Als Beispiel ziehen sie die USA heran. Sie stellen fest, dass die Idee des amerikanischen ‘Melting Pots’, der Konstruierung einer verbindenden, ethnische Unterschiede relativierenden nationalen amerikanischen Identität, nur bedingt funktioniert hat. Die Idee des Melting Pot funktioniert über eine gemeinsame Sprache und materielle Kultur. Doch die ethnischen Gruppen können, was die Ansichten über Politik, Ehe etc. anbelangt, noch immer völlig verschieden sein. Dies rührt daher, dass die ersten Einwanderer, vornehmlich die Briten, die Bezeichnung ‘American’ für die von ihnen hochgehaltenen Werte benutzten (Protestantismus, wirtschaftliche Effizienz etc.) und sich, vornehmlich aus ökonomischen Gründen, von den späteren Einwandergruppen abgrenzten. So wird Primordialismus bei Glazer/Moynihan (1963/1996) ein Begriff, der in gewissen Situationen zum eigenen Vorteil instrumentalisiert und transformiert wird.
[...]
[1] Ich verwende das Wort ‘Diskurs’ im Sinne Michel Foucaults. Foucault definiert ‘Diskurs’ als begrenzte Gebiete sozialen Wissens, als System von Aussagen, die die Welt erklären und gleichzeitig konstituieren (Ashcroft/Griffiths/Tifflin 2007: 62).
2 Siehe Dom za vesanje (Time of Gypsies, R: Emir Kusturica, GB/I/YU 1999) oder Crna macka, beli macor (Black Cat, White Cat, R: Emir Kusturica, F/D/YU/AT 1998).
- Quote paper
- Simon Meier (Author), 2010, Der Ethnizitätsdiskurs der Roma mit Fokus auf die Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148925
Publish now - it's free
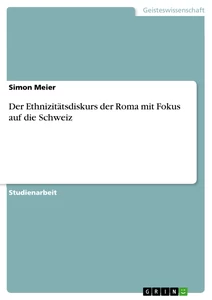

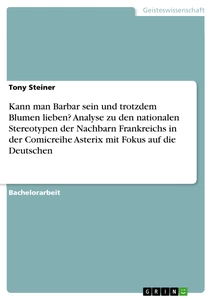
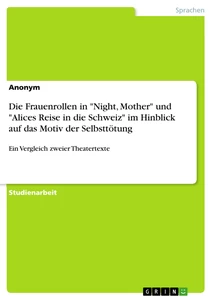
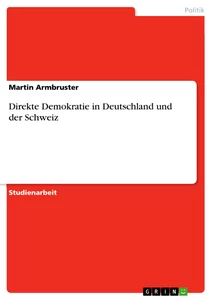


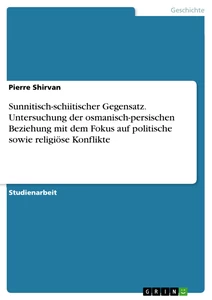
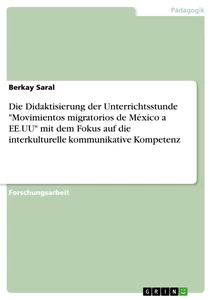

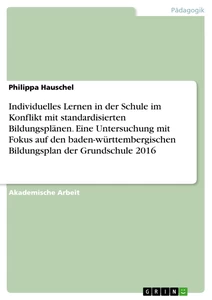
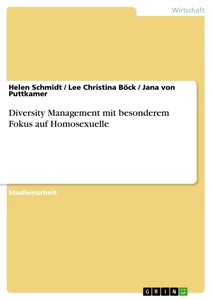
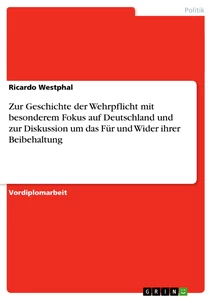

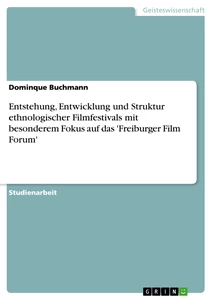
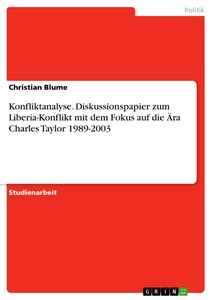
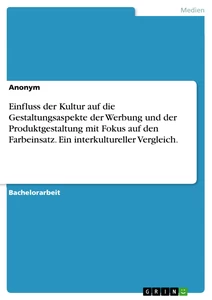
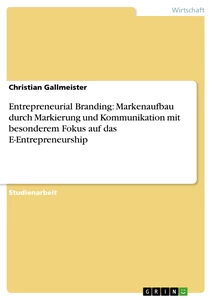
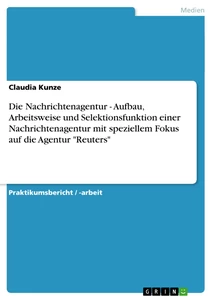
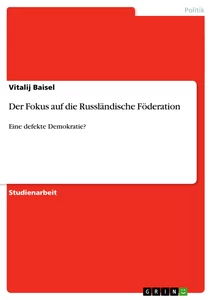
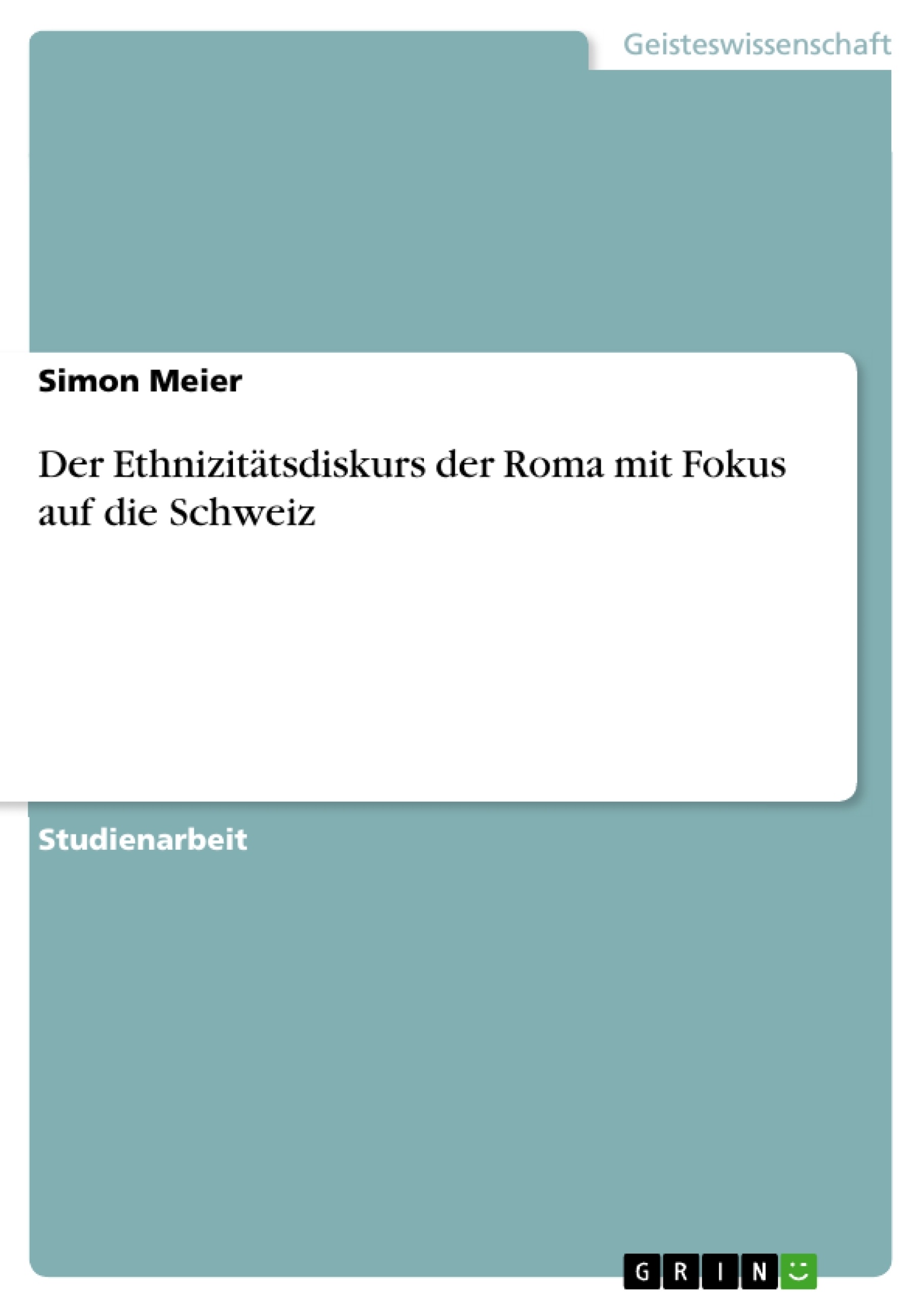

Comments